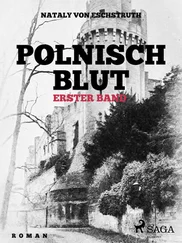„Was er leistet?“ versetzte der junge Mann mit hochgezogenen Brauen. „Je nun: er macht sich angenehm! Soviel ich weiss, ist er ursprünglich Rechtsanwalt gewesen — hat vielleicht mal irgend einem würdigen Hauptschuft durch ein glänzendes Plaidoyer über die Barriere geholfen und sich dadurch einen Namen gemacht, der ihn in der Gesellschaft günstig einführte. Von seiner Herkunft weiss ich nichts — wahrscheinlich gehört die Familie zur französischen Kolonie, denn der Mann ist unzweifelhaft mit Spreewasser getauft — du weisst doch, Onkel, bei dem richtigen Berliner hat der hugenottische Perouquier und der emanzipierte Jud’ Pathe gestanden; ein reines Produkt von Sand und Kienäpfeln ist diese Sorte nicht! — Na, also eines Tages gehört Doktor Gisbert Renard zur Gesellschaft, hat Geld die Hülle und Fülle — kein Mensch weiss, woher, sein Name taucht immer öfter in den Zeitungen auf als Mitglied eines Komitees zur Feier des vierzigjährigen Jubiläums irgend eines eitlen Mimen, des sechzigsten Geburtstages irgend eines Künstlers oder Gelehrten, als Verfasser eines launigen Gelegenheitsgedichtes oder auch einer ernsthaften Flugschrift. Man sieht ihn heute Arm in Arm mit Virchow unter den Linden spazieren und tuschelt sich morgen etwas über sein Verhältnis mit der jungen Frau Kommerzienrätin so und so in die Ohren; dann taucht er wieder in irgend einem Luxusbade als Freund einer graziösen Tänzerin auf; übermorgen hält man ihn allgemein für den Verfasser eines aufsehenerregenden politischen Artikels in den Grenzboten — plötzlich ist er zum Aerger von einigen Dutzend jungen Damen verheiratet, dann gibt es ein anmutiges Skandälchen, hier und dort ein bisschen sittliche Entrüstung über Madame oder Monsieur, je nachdem — aber jedenfalls viel Vergnügen, und schliesslich grosse Freude bei der Nachricht, dass Madame mit Hinterlassung einiger Kinder ihm davongelaufen ist! Als Anwalt praktiziert er, glaube ich, schon lange nicht mehr; aber wunderbar bleibt es doch, wozu der Mann und so viele seinesgleichen immer Zeit haben!“
Der Kellner brachte die bestellten Speisen, und während des Essens sprang das Gespräch nunmehr flüchtiger von einem Gegenstand auf den andern über. Lori beteiligte sich nur sehr wenig daran, ebenso wie sie an ihrem Gerichte nur zerstreut herumschnitt und nur winzige Bissen davon zu sich nahm, wie ein satter Vogel, der noch ein Stückchen Zucker zu picken bekommt. Sie ass wie eine vornehme Dame, welche der Sauberkeit einer öffentlichen Küche nicht traut, und handhabte das Bierglas mit einem gewissen scheuen Missbehagen. Der Vater schalt sie gutmütig aus ob ihrer Kostverachtung und der Vetter Referendar konnte sich nicht enthalten, sie ein wenig mit ihrem Provinz-Damentum zu necken. Doch sie wies Vorwürfe wie Neckerei mit der ruhigen Bemerkung zurück, dass sie nach einer heftigen Gemütserschütterung, wie sie das gewaltige Spiel des Fräuleins Pospischill als Adelheid in der Scene mit dem Vehmrichter in ihr verursacht habe, niemals viel essen könne und dass es ihr überhaupt nicht angenehm sei, unter lauter Fremden und zudem in solcher Luft zu speisen.
Der Vetter lachte: „Ich glaube wahrhaftig, Lori, dich hat die Scene stärker mitgenommen, als die Pospischill selber.“
„Ich kann nicht glauben,“ versetzte Lori, „dass eine Schauspielerin, die andern so mächtig ans Herz zu greifen weiss, selbst ganz ungerührt bleiben sollte von dem Furchtbaren, das sie darzustellen hat. Ein Weib, das ihren Gatten so schamlos hintergeht, ihn dann kaltblütig tötet und nun den Rächer in so unheimlicher Gestalt herankommen sieht — das ist etwas so Entsetzliches, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie eine Frau sich in eine solche Rolle hineinzuleben vermag!“
„Nun ja, jede vermag’s auch nicht,“ belehrte der junge Schlichting; „dazu muss eine schon ein bisschen den Teufel im Leibe haben. Einer meiner Freunde, ein vortrefflicher Musiker, klagt geradezu sein unglückliches Schicksal an, weil es ihn zu einem so rettungslos anständigen Menschen gemacht habe, — er behauptet, vom grossen Lumpen bis zum grossen Künstler sei nur ein Schritt, und die Tugend ein für allemal unproduktiv!“
Der Freiherr schüttelte den Kopf: „Wo soll das hinaus? Diese Verachtung aller Tugend, Treu und Ehrlichkeit ist auch so eine kostbare Errungenschaft unsres freimaurerisch-reformjüdischen Jahrhunderts.“
Der Referendar wusste bereits, dass der gute Oheim in seinem seltsam krausen Studiengange in jüngster Zeit zu der grossen Entdeckung gelangt war, dass für alle Niedertracht der Gegenwart einzig und allein die Logenbrüder und Reformjuden verantwortlich zu machen seien. Er wusste auch, dass der Onkel kein Erbarmen kannte und kein Ende fand, wenn man unvorsichtig genug war, sich auf dies Thema mit ihm einzulassen. Er liess daher seinen Einwand auf sich beruhen und drückte sich etwas allgemein also aus: „Ja, ja: man immer dicke durch? Wie der Berliner sagt! Nur nicht umsehen und stehen bleiben, wenn man einen unterwegs umgerannt hat; wenn man nur selbst früh genug ankommt. Rücksicht, Höflichkeit sind Lügen — nicht nur im Deutschen! Aber die Lüge ist freilich oft ein nützliches Ding.“ Er sagte das mit der wichtigen Miene des welterfahrenen Mannes, der den armen Hinterwäldler wohlwollend belehrt. „Gelt Onkel, im Reichstag lernt man auch bald genug, diesen Gassenhauer nachpfeifen! Wie gefällt es dir eigentlich in dem hohen Hause?“
Der wohlbeleibte Pommer putzte sich mit der feuchten Serviette den Bart, seufzte und sprach: „Wenn man so, wie ich, mit der Absicht hierhergekommen ist, seinem Volke Zufriedenheit zu schaffen, ehrliche Arbeit zu belohnen, widerstreitende Interessen nach Kräften zu versöhnen, dann kann es einem bald schwer ums Herz werden! Man möchte wirklich wünschen, man wäre ein Erzeinfaltspinsel oder ein Türke, mit dem Kismet bewaffnet! Na, lassen wir das lieber! Ich bin wohl auf meiner Scholle zu alt geworden und verstehe die Welt nicht mehr. Du bist ein junger Mann, Günther, ich will dir keine Illusionen rauben. Illusionen bedeuten Thatkraft — behalte das nur immer im Auge! Du bist ein guter Kopf, ein scharfer Beobachter, das erkenne ich aus allem, was du sagst. Die Zukunft hat solche Köpfe nötiger als meinen pommerschen Dickschädel! Lass dir nicht bange machen, mein guter Günther!“
Der Referendar liess seinen Kneifer von der Nase fallen und schlug in des Onkels dargereichte Rechte ein. Der brave Herr kam ihm mit seiner Manier „des Lebens Unverstand mit Wehmut zu geniessen“ recht abgeschmackt vor und er dünkte sich in seiner weltstädtischen Aalhaut dem schleppfüssig dahinwandelnden und vor jedem neuen Thore stutzenden Provinzler unendlich überlegen. Er vermochte ein etwas spöttisches Lächeln nicht ganz zu verbergen — und Loris klaren Augen war dies Lächeln und seine Bedeutung nicht entgangen.
Sie mahnte zum Aufbruch und die Herren mussten ihr wohl oder übel Folge leisten, obwohl sie gern noch eine Halbe getrunken hätten.
Gleichzeitig mit ihnen stand auch Herr Renard vom Nachbartische auf. Lori erhob die Arme, um ihren Schleier auf dem Hinterhaupte festzubinden, während der Vetter hinter ihrem Rücken den weiten Mantel, zum Umlegen bereit, ausgebreitet hielt. Renards scharfe, lebhafte Augen hingen voll Bewunderung an ihrer schlanken Gestalt, deren vollendete Formen eben jetzt ihre Haltung zur besten Geltung brachte. Das junge Mädchen fühlte unter dem Schleier, wie sie errötete, und raffte mit einer raschen, ärgerlichen Wendung den Mantel um. Das Spitzentuch, das sie vorhin über den Kopf geworfen hatte, hing jetzt unbenutzt über ihrem Arm. Sie nestelte noch an ihrem Handschuh beim Hinausgehen.
Renard verabschiedete sich hastig von seinen Freunden und eilte dann der schönen Fremden nach. Ah, welch ein Glücksfall! Auf einer der obersten Treppenstufen lag ihr schwarzes Spitzentuch. Er hob es auf, und am Fuss der Treppe angekommen, schaute er um sich und drückte, da er sich unbeobachtet sah, tief aufatmend sein Gesicht hinein. Er vermeinte den feinen, vornehmen Duft ihres Haares einzuatmen, er küsste das Tuch — und dann trat er rasch auf die Strasse hinaus.
Читать дальше