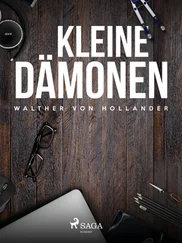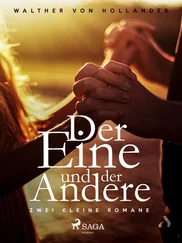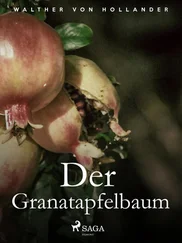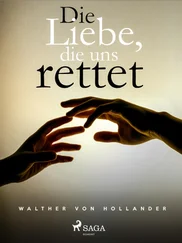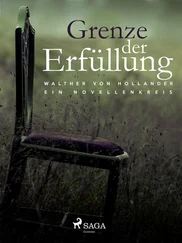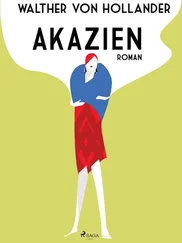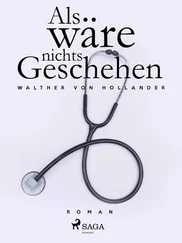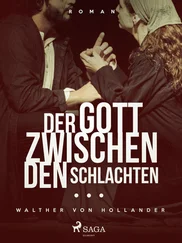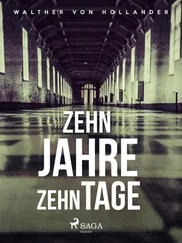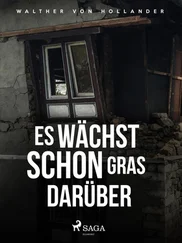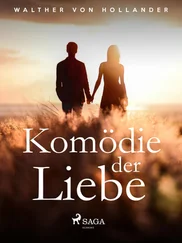Manchmal setzt Stefanie an, von ihrer Reise zu erzählen. Himmel, das schien doch noch auf der Heimreise ganz beachtenswert: der Flirt in Baden-Baden mit dem javanischen Prinzen, der einen so unaussprechbaren Namen hatte und den sie Prinz Etepetete taufte, weil er immer so hübsch saubere Bewegungen und hübsch saubere weiße Anzüge besaß.
„Da war also in Baden-Baden der Prinz Etepetete,“ beginnt sie, „den hatte ich so getauft, weil…“
Sie stockt. Denn Leo Landowski führt ihre Erzählung zu Ende: „Mit dem also flirtete ich, weil es mir Spaß machte, daß so viele Frauen sich an ihn herandrängten, die er immer gleich wegschob, wenn ich kam.“
„Ja, genau so war es,“ nickte sie ernst, „kein bißchen anders. Es wurde dann leider langweilig. Denn er saß immer nur und lächelte liebenswürdig, und manchmal gurgelte er etwas, was wohl eine Schmeichelei war, und manchmal sagte er: ‚S—chöne Frau‘, als wenn er aus Westfalen wäre.“
„Wann kommt er nach Berlin?“ fragt Leo, „oder vielmehr, wann ist er da?“
„Ja, denke dir, Amélie Stern hat mir gestern schon von ihm erzählt. Er wird der Clou der nächsten Saison, und darum soll er bei Sterns javanische Tänze vorführen. In Garmisch tanzte ich immer mit einem schönen Mann. Der sagte auch nichts, obwohl er ein Deutscher war. Nachher hieß er Schneisecke. Da bin ich denn in die Schmölz hinausgezogen und habe Sonnenbäder genommen, bis ich gemerkt habe, daß hinter den verschlossenen Fensterläden des gegenüberliegenden Hauses ein reger Verkehr von Männern stattfand, die mir heimlich fernglasbewehrte Augen zuwarfen. Außerdem erklärte der Wirt, daß man die Juden ausrotten müsse, so wenig gegen den einzelnen zu sagen sei.“
„Schließlich in Sils Maria wurde es ernst,“ erzählt sie am zweiten Tag, während sie gerade wieder in dem Restaurant an der Friedrichstraße essen, „da war ein Herr von Pfennig. An dem war nur der Name komisch. Sonst war er ein reizender, hübscher Kerl, amüsant, klug, sehr jung, ich glaube einundzwanzig. Der wäre mir fast gefährlich geworden. Leider war er aus Wien und hatte dadurch veraltete erotische Manieren, die er für reizvoll und originell hielt.“
Sie hört mit dem Erzählen auf. Es kommt ihr alles unsäglich albern vor. Sie sieht Leo genau an. Er hat sein höfliches und lachendes Zuhörergesicht, und es ist nicht herauszubekommen, was er denkt.
„Sag’ mal,“ beginnt sie nach einer Weile zögernd, „bin ich eigentlich weggefahren, um zu abenteuern?“
„Ich glaube es nicht“, sagt er und steht auf. Als sie wieder am Büro angekommen sind, fügt er beim Abschied hinzu: „Weißt du, mit den Gründen deiner Reise, das werden wir zunächst nicht herausbekommen, und ich schlage darum vor, wir stellen alles eine Weile zu dem anderen Ungeklärten in den Kühlschrank.“
Stefanie meint, es stünde schon ein bißchen viel im Kühlschrank, aber als sie zu Hause die Sache noch einmal überlegt, kann auch sie zu keinem besseren Ergebnis kommen. Ehrlich sein und ehrlich bemüht sein, nützt noch gar nichts, denkt sie und sieht seufzend die Liste der Gäste vom Montag noch einmal durch, um festzustellen, ob nicht vielleicht doch Feinde zusammen eingeladen sind.
Es ist das einfach die Liste der Gäste vom vorigen Jahr, und man muß nur wenig ändern. Für den verstorbenen Rechtsanwalt Clessing kommt sein Nachfolger Rechtsanwalt Brettschneider. Den Frauenarzt Dr. Steinkopf kann man nicht mehr mit Sterns zusammen einladen, weil der Getreidehändler schließlich doch zur Kenntnis nehmen mußte, von welchem Leiden Amélie sich bei ihm heilen ließ. Es hat im Falle Steinkopf sogar eine wirklich ernsthafte Auseinandersetzung gegeben. Amélie kann das wunderschön nachmachen. „Du wirst mir noch Hörner aufsetzen“, ruft sie hamburgisch und schiebt einen imaginären Bauch vor sich her durchs Zimmer.
Also mit Steinkopf geht es nicht. Dafür kann schließlich der Filmregisseur Lutz Teller kommen, ein Schmachtlappen zwar und ein Feigling dazu. Aber Fräulein Stübbecke und Frau Maimann möchten ihn gern kennenlernen, Clara Höger will durchaus unter seiner Regie filmen, der Lyriker Teufelmann will ein Manuskript an ihn loswerden, und Milly Pabst will von ihm entdecken lassen, daß sie ein fabelhaftes Filmgesicht hat. Also in Gottes Namen: Lutz Teller. Aber dann möchte Stefanie noch irgendwas Anständiges einladen, für Leo jemanden und auch jemanden für sich selbst. Sie versinkt in Nachdenken, sie läßt alle Freunde und Bekannten vorbeispazieren. Schließlich Windschütz, der Musiker, ist ja Leos Freund und der Kunsthändler Mewes auch. Aber nein, außer Clara, die ja Inventar ist und die sie feierlich übernommen hat, soll niemand vom Fünferklub kommen. „Bist du doch eifersüchtig auf den Fünferklub?“ fragt sie sich erstaunt. Man kann es eifersüchtig nennen. Sie findet es jedenfalls dumm, wenn man einen solchen Bierulk jahrelang fortsetzt.
Also es ist niemand da, den man von Herzen einladen kann, und so schließt sie die Liste ab und schickt sie zur Erledigung ins Büro.
Damit beginnt das gewöhnliche Leben wieder, die Reihe der Tage, von denen man nichts Besonderes erwartet, die kommen und gehen können, ohne daß man sie zählt und wertet und zwischen denen doch immer das heimliche Herzklopfen auftaucht, die Angst, es könnte, der Wunsch, es möchte alles schnell vorbei sein oder doch wenigstens sich endlich ändern, damit man mit allen Kräften beginnen kann.
In den ersten Tagen ist Stefanie noch erstaunt, versucht mit all den Kleinigkeiten mitzulaufen, die ihr Leben ausfüllen, steht dann mit einem Ruck still und läßt die Menschen und Dinge vorbeilaufen. Leo hilft ihr sehr schön dabei, wenn er es auch auf seine Weise ausdrückt. „Nichts ernst nehmen,“ sagt er oft in diesen Tagen, „nichts ernst nehmen. Es kommt bestimmt mal wieder — und dann kann man es immer noch ernst nehmen.“
Mit dem Wiederkommen scheint er ja wirklich recht zu haben: Die Gesellschaft findet am Montag in den gleichen Räumen wie immer statt. Man muß sich Mühe geben, eine andere Speisenfolge auszudenken, und wenn man dieselbe machte, würde es auch niemand merken.
Wie immer, kommt Geheimrat Lerchenstätt, einer der Botaniker der Universität, als erster. Er schwingt einen Strauß von verschiedenen Feldblumen vor sich her, deren lateinische Namen er an Stelle einer Begrüßung und eines Witzes deklamiert. Es folgen Direktor Knesebeck und Frau, dann Amélie Stern in einem bezaubernden Kinderkleidchen aus fliederfarbenem Chiffon, das weit über die Grenzen des Möglichen lichtdurchlässig ist. Sie bringt diesmal ihren Mann gleich mit, einen kleinen, dicken Herrn, dessen joviale Fröhlichkeit durch die stete Sorge um den Besitz seiner Frau gedämpft ist und nur noch selten in einem krampfhaften Lächeln durchbricht. Es erscheint, unscheinbar um sich lächelnd, der Filmregisseur Lutz Teller, ein noch junger Mann mit Birnenkopf und den melancholischen Augen des Erfolgreichen. Er beschäftigt sich ausschließlich mit Leo, der ihm imponiert und dessen Millionen vielleicht noch einmal zu brauchen sind.
Nach ein paar kleinen Leuten, von denen höchstens die Bühnenschönheit Milly Pabst erwähnenswert ist, deren nicht ganz einwandfreie Oberschenkel durch einen Kulturfilm der Öffentlichkeit übergeben wurden, und Frau Leonie Weiland, die sich selbst eine Kurtisane nennt, kommt Clara Höger, zur größten Überraschung aller Anwesenden im hochgeschlossenen schwarzen Seidenkleid, bei dem allerdings unten abgenommen zu sein scheint, was oben dazugekommen ist.
Sie ist sicherlich die auffälligste Erscheinung. Bei sehr fraulichen Formen hat sie einen hageren Körper, dünne Arme und Beine, ein überstrenges Gesicht mit hervortretenden Backenknochen und einem sehr großen schmallippigen Mund. Ihr außerordentlich dickes und festes braunes Haar trägt sie als eine Krone. Diese Frisur stimmt nur schwer zum Ausdruck des Gesichts, der lasterhaft zu nennen wäre, wenn man nicht unter Laster jetzt die Spielereien kleiner Mädchen verstünde. So wird man das Gesicht eher verbissen finden, erstarrt jedenfalls von einer Ruhe oder Kälte, die nahe am Herzen sitzt, während die Nerven der Haut sehr empfindlich sind und gern und heftig reagieren.
Читать дальше