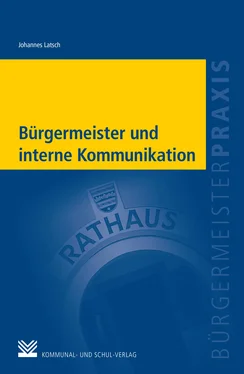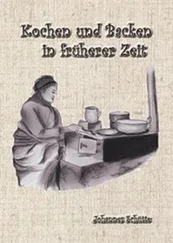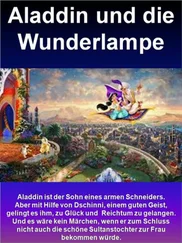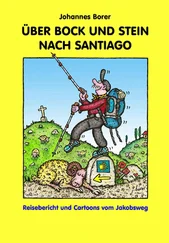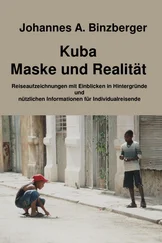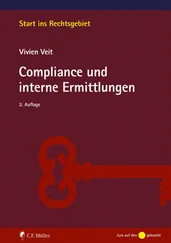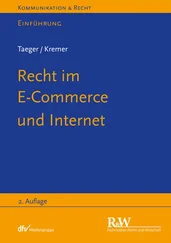Wir müssen hier kurz den Unterschied zwischen Urheber- und Verwertungsrecht festhalten: Das Urheberrecht kann nicht übertragen werden, der Schöpfer bleibt geistiger Eigentümer, auch wenn andere seine Texte und Bilder nutzen. Das Verwertungsrecht hingegen lässt sich sehr wohl weiterreichen, auch verkaufen. Damit erlaubt zum Beispiel ein Fotograf seinem Auftraggeber, sein Bild in externen oder internen Veröffentlichungen zu verwenden. Bei externen Fotografen wird das in der Regel über Honorarverträge geregelt. Wer jetzt ein wenig weiterdenkt, wird sofort auf die Konsequenz stoßen, dass eine weit verbreitete Praxis schlichtweg illegal ist. Wer sich zum Beispiel über das allseits beliebte „Google Bilder“ aus dem Netz Bilder herunterlädt, um damit ein Veranstaltungsplakat, ein Intranetposting für die Mitarbeiter oder den Flyer zum Fortbildungsprogramm optisch aufzupeppen, weil es an Archivfotos und -grafiken in den eigenen Datenbänken fehlt, verstößt gegen das Verwertungsrecht; es sei denn, er hat sich dieses Recht explizit gesichert. Ein konkretes Beispiel: Lädt die Interne Kommunikation für einen Beitrag zur gesunden Haushaltslage einen Dagobert Duck im Geldbad als Illustration herunter, ohne sich um die Erlaubnis geschert zu habe, dann verstößt sie gegen das Gesetz. Nur weil ein Bild ins Netz gestellt wird, kann es nicht frei genutzt werden, da hilft auch kein Feigenblatt nach dem Prinzip „Quelle: Google“ oder „Quelle: Walt Disney “. Mit anderen Worten: „Google – copy - paste“ ist nicht.
Praktiker wenden an dieser Stelle drei Dinge ein: „Wir nehmen das Bildchen doch nur rein intern als Gag, wir verdienen damit keinen Cent, und Disney kriegt das eh nicht mit. Wo kein Kläger, da kein Richter.“ Ein schmaler Grat. Den ersten Punkt haben wir schon geklärt; auch eine interne Verbreitung ist eine Verbreitung. Der zweite Punkt ist juristisch unerheblich: Auch wer mit seinem Rechtsbruch kein Geld verdient, begeht immer noch einen Rechtsbruch. Und der dritte Punkt: Ja, kann sein, dass Disney das nicht mitbekommt, wenn die 3000-Seelengemeinde XY im internen Rundschreiben den Dagobert Duck abbildet. Aber da stellt sich für die Gemeinde die Gewissensfrage: Sollte sie sich als Behörde und damit Organ des Rechtsstaats über die Gesetze stellen, die für jeden ihrer Bürger gelten? Wenn der Staat hier Recht bricht – wie kann er es dann einem privaten Häuslebauer verübeln, der Teile seines Eigenheims anders nutzt als im B-Plan vorgesehen, oder der die Gebäudehöhe in der Baugenehmigung um einen halben Stock überschreitet?
Um aus der Bredouille zu kommen, bietet sich als kostenlose Alternative zum Beispiel die Plattform Pixabay 32an. Dort ist eine Masse von Bildern eingestellt, die über Suchbegriffe erschlossen und frei verwendet werden können. Dazu muss die Verwaltung nicht einmal das Portal als Quelle angeben – freilich wäre es ein fairer Zug, das zu tun, um zumindest auf diese Weise den Fotografen eine Anerkennung zukommen zu lassen. Selbst übergeordnete Behörden bedienen sich dieser Plattform; der Autor hat es selbst erlebt: Während der ersten Phase der Krise um das Corona-Virus 2020 suchte der Autor für eine Intranet-Meldung eine Illustration zum Thema „Virus“. Er fand sie auf der Plattform, lud sie herunter – und stellte ein paar Minuten später fest: Das für die Bekämpfung der Pandemie zuständige Landesministerium hatte für seine Internetseite exakt die gleiche Illustration genutzt.
Soweit die Frage von externen Quellen. Was aber ist, wenn Kollegen der eigenen Verwaltung solche Werke als Text oder Foto herstellen? Sind das nicht eigene Mitarbeiter, die jegliches Schaffen in den Dienst des Arbeitgebers gestellt und ihm damit sämtliche Rechte übertragen haben? 33Nicht ganz. Die Interne Kommunikation kann solche Schöpfungen nicht ohne Weiteres nutzen, bloß weil die Urheber auf der Gehaltsliste der eigenen Kommune stehen. Wir unterscheiden dabei zwei Arten von Werken: das, was im Verlauf der ureigenen Arbeit und Zuständigkeit entsteht, und das, was der Mitarbeiter darüber hinaus quasi als Privatperson schafft, auch wenn es Dienstliches oder Quasi-Dienstliches berührt.
Der erste Fall – die Werke entstehen im Rahmen der eigenen Arbeit und Funktion – ist für die Verwaltung unproblematisch. Nehmen wir einen Pressesprecher, der den Text für den internen Flyer zum Fortbildungsprogramm entworfen hat. Er behält zwar das Urheberrecht; aber er überträgt seinem Arbeitgeber automatisch das Verwertungsrecht, weil das Schreiben solcher Texte zu seinen beruflichen Aufgaben gehört. Ähnliches gilt etwa für die Autoren von internen Berichten wie dem Rapport der Frauenbeauftragten oder der Schwerbehindertenvertretung. Zwar wird unter Juristen diskutiert, ab welcher Grenze ein solches Werk als „persönliche geistige Schöpfung“ gilt, wie es das Urheberrechtsgesetzes (UrhG) formuliert. In aller Regel aber muss jemand, der interne Berichte oder zum Beispiel dienstliche Texte für das Intranet erstellt, in Kauf nehmen, dass sie auch ohne seine ausdrückliche Einwilligung im Rahmen der Internen Kommunikation vielfältig genutzt werden.
Anders die Lage im zweiten Fall. Schreibt ein Mitarbeiter Texte, die über das rein Fachliche hinausgehen, und will die Interne Kommunikation das in hausinternen Kanälen veröffentlichen, sollte sie das mit ihm geklärt haben. Wenn jemand etwa in einer persönlichen Mail an ein paar Kollegen Anekdoten vom jüngsten Betriebsausflug schildert, darf die Interne Kommunikation den Text nicht einfach als Randschmankerl in die Mitarbeiterzeitung übernehmen; sie muss seine Erlaubnis einholen. Auch wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel als Privatperson Internet-Postings veröffentlicht, darf die Verwaltung solche Texte nicht ohne seine Erlaubnis für interne Zwecke verwenden.
Vom Text nun zum Bild. Juristisch betrachtet überlagern sich in einem Foto Fragen des Urheberrechts, des Verwertungsrechts und des Persönlichkeitsrechts. 34Schießt zum Beispiel beim internen Sommerfest ein externer Fotograf das Bild eines Mitarbeiters und die Intranet-Redaktion veröffentlicht anderntags ohne Einwilligung beider den Schnappschuss auf der hausinternen Plattform, dann könnten – zumindest theoretisch – beide klagen: der Fotograf, weil sein Urheber- und Verwertungsrecht verletzt wurde, und der Fotografierte, weil das Bild sein Persönlichkeitsrecht verletzt, nämlich das Recht am eigenen Bild. Zivilrechtlich könnten beide die Entfernung des Bildes fordern; strafrechtlich könnte der Fotografierte Schadensersatz verlangen, wobei er allerdings beweisen müsste, welchen Schaden er erlitten hat. In aller Regel aber landet derlei nicht vor Gericht, sondern Fotograf, Mitarbeiter und Intranet-Redaktion werden sich auf dem kurzen Dienstweg einigen, ob sie das Foto stehen lassen oder aus der Bildergalerie des Sommerfestes entfernen. Dennoch ist es wichtig, die zumindest möglichen Konsequenzen zu kennen. Die Interne Kommunikation als Teil der öffentlichen Verwaltung sollte rechtlich sauber arbeiten.
Wieder anders liegt der Fall beim hausinternen Pressespiegel. Da geht es nicht um persönliche Absprachen, da geht es um genau definierte Rechte, die gegen Geld erworben werden. Auf den ersten Blick hat der Pressespiegel nichts mit Interner Kommunikation zu tun – geht es hier doch um externe Texte und Veröffentlichungen. Genauer betrachtet können wir das Presseclipping aber doch zur Internen Kommunikation zählen; schließlich stellt sich hier die Frage, auf welchen Wegen intern Informationen übermittelt werden.
Egal, wie der Pressespiegel verbreitet wird – als Printkopie, per pdf und Mail oder als Modul auf der Intranetseite: Die Verwaltung muss die Rechte geklärt haben. Sie muss die Erlaubnis der großen Verwertungsgesellschaften einholen, bei der PMG für elektronisch verbreitete Pressespiegel, bei der VG Wort für Papierversionen. Und diese Organisationen mit Monopolstellung lassen sich das gut bezahlen; sie streichen für die Verwendung von Artikeln saftige Gebühren ein. Je nach Größe des Verteilers kann selbst ein Einspalter aus der FAZ an die zwei Euro kosten. Es gibt verschiedene Varianten für die so genannte Lizensierung – also die Erlaubnis, Medienartikel einer bestimmten Zahl von Nutzern im Haus zugänglich zu machen. Die Günstigere ist die Option nach § 49 des Urheberrechtsgesetzes. Sie erlaubt die Vervielfältigung von Artikeln zum politischen, wirtschaftlichen und religiösen Tagesgeschehen. Nicht darunter fallen beispielsweise Artikel aus dem Bereich kulturelles Leben oder – kurz gesagt – mehr oder weniger Geschichten jenseits des Tagesgeschäfts. Auf den Punkt gebracht: Der Artikel zur Haushaltsrede des Bürgermeisters zählt dazu, der Bericht über die neue Kunstausstellung im Rathaus nicht. Die Verwaltung muss sich also überlegen, wie breit das Spektrum sein soll, das der Pressespiegel abdeckt.
Читать дальше