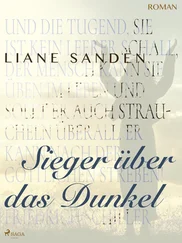Malte Rasmussen brauchte nicht lange Zeit, um einen Betrieb ganz zu durchschauen. Er hatte es sehr bald heraus, dass hier alle Schwestern und sogar die jungen Ärzte vor der Oberin zitterten. Die Oberin war die rechte Hand des Chefs und hatte das Krankenhaus im Zuge wie kaum jemand anders. Aber Malte Rasmussen fand, dass das nicht genug wäre. Er hatte sich gar nicht gescheut, der Oberin ein paarmal sehr energisch die Meinung zu sagen, weil der „Kasernenton“, wie er ihn im geheimen nannte, ihm im Krankenhaus nicht angezeigt erschien.
„Ich glaube, dass ich etwas länger im Krankenhausbetrieb bin, Herr Doktor“, hatte die Oberin scharf erklärt, „um mehr Erfahrung zu besitzen.“
„Vermutlich sind Sie eben schon zu lange drin, Frau Oberin“, war Malte Rasmussens Entgegnung gewesen, „es gibt Leute, bei denen die Länge der Zeit nur schädigend wirkt.“
„Ob meine Methode für das Krankenhaus schädigend ist oder nicht, Herr Doktor, diese Entscheidung wollen Sie bitte Herrn Geheimrat überlassen“, hatte die Oberin darauf erklärt.
Aber auch vor dieser Beschwörung duckte sich Malte Rasmussen nicht, wie er sich nie im Leben vor etwas duckte, wenn er es für nötig hält, eine Sache durchzukämpfen.
„Falls Sie die Entscheidung des Geheimrats wünschen, Frau Oberin, steht dem nichts im Wege. Es geht mich auch nichts an, wie Sie andere Stationen leiten. Das untersteht meinen Kollegen. Für die Station, für die ich verantwortlich bin, erkläre ich Ihnen, dass ich einen humaneren Ton meinen Kranken gegenüber verlange. Falls Sie sonst etwas wünschen, bitte, der Beschwerdeweg steht Ihnen offent.“
Trotz seiner Wut musste er innerlich lachen. Die Geschichte von der zur Salzsäule erstarrten Frau Lot kam ihm unwillkürlich in den Sinn, wie er die erstarrte Gestalt, das versteinerte Gesicht der Oberin sah. Die Schwestern ringsum standen wie verschüchterte Hühner, wenn der Habicht unter sie fährt. Einen Augenblick machte sich Malte Vorwürfe, dass er diese Auseinandersetzung mit der Oberin in Gegenwart der Schwestern geführt hatte. Aber schliesslich war ja sie es gewesen, die versucht hatte, ihn auch vor den Schwestern zu ducken. Das war eine Frau, die man nicht mit Glacéhandschuhen anfassen konnte. Und Malte Rasmussen lag es viel mehr, mit den Fäusten anzupacken als mit Glacéhandschuhen. Das heisst nur, wenn es sich um gesunde Menschen handelte. Seinen Kranken gegenüber war er trotz aller ärztlichen Bestimmtheit von zartester Behutsamkeit. Aber mit dem „Wachtmeister“ hier musste der Gang einmal gewagt werden.
Als Rasmussen abends ins Ärztezimmer kam, hatte der Krach mit der Oberin das ganze Krankenhaus durchlaufen und in der Phantasie der andern ungeheure Dimensionen angenommen.
Der kleine Doktor Benfag, ein unglückseliges verschüchtertes Kerlchen; das ewig für seine Existenz um Entschuldigung zu bitten schien, meinte, den langen Doktor Rasmussen halb erschrocken, halb bewundernd von unten her anschauend:
„Na, wissen Sie, Rasmussen, Mut haben Sie, sich der Oberin entgegenzustellen. Ich würde es nicht wagen.“
„Würde Ihnen auch schlecht stehen“, spottete Doktor Weber vom oberen Ende des Tisches her.
„Na, und Sie? Würden Sie es vielleicht riskieren?“ Doktor Benfang war gekränkt. Er liebte es nicht, an seine körperliche Unzulänglichkeit erinnert zu werden.
Weber säbelte ein grosses Stück Leberwurst von seinem Deputat ab:
„Riskieren vielleicht“, meinte er, aber tun nicht. Man sollte niemals mit der hohen Regierung kämpfen.“
Rasmussen, der zwischen Weber und einem andern Kollegen sass, musste lachen:
„Ich versteh euch nicht, Herrschaften. Da redet ihr immer alle grossen Töne gegen die Überschätzung der Weiblichkeit und fühlt euch, bloss weil ihr Männer seid, als kleine Herrgötter. Und auf einmal kriecht ihr vor der Hartung alle ins Mauseloch. Zum Donnerwetter, ist sie der chef?“
„Sie sind noch sehr jung, Rasmussen.“ Weber besah sich kritisch die Leberwurst. „Natürlich wieder Sorte zwei“, sagte er missbilligend, „der Ausschank hier wird auch immer schlechter; wenn es nicht freie Station wäre, würde ich meinen Abendbrottisch hier schon längst gekündigt haben. — Aber was die Hartung anlangt, so verstehen Sie nichts von der Politik. In der Politik ist die Nebenregierung doch oft genug einflussreicher als die wirkliche. Gerade so ist es bei der guten Hartung. Ohne die ist der Chef doch ein verlorener Mann. Sie ist die einzige, die ihm den Laden schmeisst. Na, und darum also.“
„Und darum kümmere ich mich den Dreck“, erklärte Doktor Rasmussen entschieden. „Wenn ich eine Kaserne wollte, hätt’ ich ja können Soldat werden. Da ich aber Arzt geworden bin und eine Krankenhausstation leite, verlange ich Menschlichkeit.“
Doktor Weber lächelte spöttisch: „Vorläufig sind Sie noch der Schillersche Jüngling, der mit tausend Segeln der Hoffnung hinausgeht. Sie werden auch noch mal still und resigniert in den Hafen zurückkehren.“
„Nie, niemals resigniert, was meine Auffassung vom Arztsein anlangt. Arztsein verpflichtet, Kollege Weber.“
Weber kaute mit vollen Backen: „Na schön, mag’s verpflichten. Ich bin mehr dafür, dass es zu guten Einnahmen verpflichtet. Aber ich will mich mit Ihnen nicht streiten. Sie sind mir zu forsch. Toben Sie sich ruhig gegenüber der guten Hartung aus. Sie werden ja sehen, wer den Kürzeren zieht, wenn die erst den Chef gegen Sie scharfmacht.“
„Wenn der Chef einen Menschen, den er für tüchtig hält, fallen lässt, nur weil dieser Mensch eine berechtigte Auseinandersetzung mit einem andern hatte, dann pfeife ich auf die Stellung hier.“
Rasmussens bis jetzt gleichmütiges Gesicht war finster geworden. Er stand auf, schob den Stuhl zurück: „Mahlzeit!“
„Nanu, schon fertig?“ fragte Doktor Weber kauend. „Sie haben ja noch kaum die Hände zum lecker bereiteten Mahl erhoben.“
„Nee, danke. Der Appetit ist mir vergangen.“
„Komisch“, meinte Doktor Weber, „wie einem der Appetit vergehen kann. Ist doch schliesslich noch das einzige, was im Leben Spass macht. Na, geben Sie mir noch einmal den Käse her, Herr Benfag.“
Die Abendvisite war vorbei. Rasmussen kam eilig aus Station 3b. Ihm entgegen Schwester Christine.
„Also, Schwester Christine, die kleine Grete bekommt zur Nacht einen Ölumschlag, sollte sie sehr unruhig sein, dann ein halbes Luminal.“
„Verzeihung, Herr Doktor, ich bin heute dienstfrei“, sagte Schwester Christine.
„Na schön. Wer vertritt Sie?“
„Schwester Helene.“
Rasmussen sah Christine scharf an:
„Wie sehen Sie denn aus, Schwester Christine? Haben Sie Schnupfen oder haben Sie geweint?“
Schwester Christine schüttelte heftig den Kopf. Aber Rasmussen sah doch, wie sie mit den Tränen kämpfte.
„Hat’s wieder einen Kampf mit der Oberin gegeben?“ fragte er lächelnd. „Na, hören Sie, Schwester Christine, wie kann man sich darüber noch aufregen? Sie sollten lieber Ihren freien Tag geniessen.“
Christine zuckte die Achseln:
„Geniessen — ach, du lieber Gott!“
Etwas sehr Verlassenes, sehr Einsames war in den paar Worten. Wärme stieg in Rasmussen auf.
„Nun seien Sie einmal vergnügt“, sagte er energisch. „Machen Sie sich fertig, wir gehen zusammen aus.“
„Aber, Herr Doktor, das ist doch unmöglich.“
Seelenruhig fragte er zurück:
„Wieso unmöglich? Glauben Sie, dass uns die elektrische Bahn nicht zusammen befördern wird, oder glauben Sie vielleicht, dass unser schätzenswertes Krankenhaus hier einstürzt, wenn wir beide irgendwo im Freien zusammen ein Butterbrot essen oder in einen Kientopp gehen oder so?“
„Wenn Sie meinen“, sagte sie, immer noch zögernd.
„Sie sollen meinen, Schwester Christine. Ich glaube, Ihr ganzes Unglück ist, dass Sie immer glauben, die andern müssen meinen.“
Читать дальше