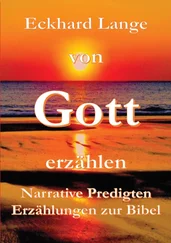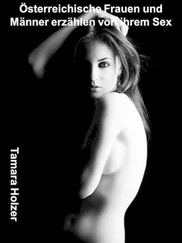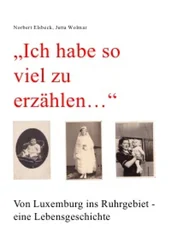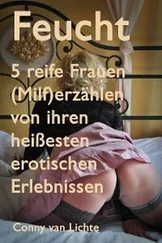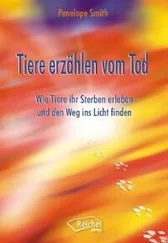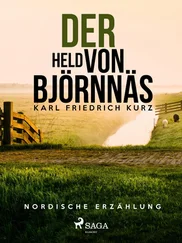Owee der langen zale
O wee der bermelichen zÿt
Eÿa wie es nu gefangen lÿt
Inn der helle pÿne
Es en ſÿ daz jme erſchyne
Vw [ er ] hilff vnd uw [ er ] troſt (N 104rb, V. 860–865)
Der Erzähler spitzt das präsentische nu im Bild einer Waagschale noch einmal zu, deren Sinken aktuell, gerade jetzt, beobachtet werden kann – die sich nu ſencket hin zu tale (ebd., V. 877). Außerhalb der geschichtlichen Welt-Zeit der Erzählung doch im Jetzt des Erzählens soll sie von Frieden und Barmherzigkeit, die der erste Abschnitt des Exkurses adressiert, wieder ausgeglichen werden:6
Nu weſent getruwelich [ bereit ]
Wie jre die wagen richtet widder
Die die warheit hat geweg [ en ] nÿder (N 104rb-va, V. 890–892)
An dieses Bild des Erzählers schließt sich ein selbstreflexiver Exkurs an; darin wird die Erzählung als Schiff beschrieben, das am Strand geankert und die Segel aus Trauer für einen Moment niedergelassen hat.7 Nach der Einladung an diejenigen, die nach Wahrheit streben, mit an Bord zu kommen, soll jetzt das Segel aufgezogen und wieder Fahrt aufgenommen werden. Mit einem erneuten Nu , das N sogar verdoppelt,8 wird der zweite Teil der Entscheidungs-Rede eingeleitet, in der Christus die argumentative Position von Friede und Barmherzigkeit übernimmt, den Plan der Menschwerdung als Lösung für das Dilemma konkretisiert und dabei das Bild der umschlagenden Waage vom Erzähler aufgreift:
Alſo will ich ſelbs an lybe
Weſen das gewychte
Das die wage richte
Vſſer duffen in den lufft
Inn den hy [ mm ] el vſſer crufft (N 105rb, V. 1016–1020)
Durch die allegorische Narrativierung und Dramatisierung des Entscheidungsmomentes, d.h. des Urteils, das sich in der Menschwerdung vollzieht, kann das Ereignishafte der Erlösung angesprochen werden, wenngleich es auch hier nicht ausgesprochen wird: Denn anders als das Sinken der Waage, das der Erzählerkommentar mit Nu markiert, und anders als die entsprechende Bitte um Ausgleich, die mit Nu eingeleitet ist, steht der Zuwurf des Gewichts noch aus. Der Wendepunkt des Heils, das Umschlagen der Waage, das im Bild des ankernden Schiffes zugleich als besonderer Erzählmoment ausgestellt wird, als Stocken, in dem die Erzählung zum Erliegen kommt, für einen Augenblick anlandet, ist so deutlich markiert.
Dass dennoch das Unerwartbare, die unmögliche Möglichkeit, die Lösung der Aporie, die der Sündenfall provozierte, das Ereignis, das weltgeschichtlich noch aussteht, durch die doppelte Zeitlogik bereits erfolgt und auch vollzogen ist, verdeutlicht der Text durch das Motiv des Kusses zwischen Gerechtigkeit und Frieden, das die Erlösung auch wörtlich dem Psalm Davids entnimmt:
Miſericordia et veritas
Frauwe Barmhertzigkeit
Vnd auch ire ſweſter warheit
Gegeneinander gingen
Mit groſſer freude empfingen
Sie ſich an den ſtunden
Nit lenger friſt konden
Wa [ nn ] mit gutten ſÿtten
Kuſte ire ſweſter frieden
Frauwe die gerechtigkeit (N 105va, V. 1066–1075)
Scheint in dieser Geste, im Kuß von Frieden und Gerechtigkeit, zunächst lediglich die Beilegung des gerichtlichen Streits besiegelt, so verdeutlicht der Lobgesang der zuvor völlig ratlosen Himmelschöre zugleich den Vollzug der – außerhalb chronologischer Zeitregime und außerhalb der Zeispanne sehnlichen Wartens – erfolgten Erlösung des Menschen: Syt du es empfang [ en ] haſt / Zu gnaden nach dem falle (N 105 vb, V. 1102f.) . Die Propheten werden hier folgerichtig nicht zu Vorläufern, sondern zu Figuren des Nachträglichen – zu Boten, die von der Lösung des Streits, dem Ereignis, das alles Folgende bedingen wird, und dem damit verbundenen Erlösungsplan berichten sollen, dessen Eintreten sie dennoch selbst erbitten und herbeisehnen.
Das Erzählen von Erlösung scheint damit in diesem Text gedoppelt: Es steht am Anfang der gereimten Erzählung Von der Beschaffung diser werlt bis auf das jungst gericht 9 – und so vermutlich nicht zufällig in dem Abschnitt, der in besonderem Maße rhetorisch überformt ist. Es steht aber zweifelsohne auch dort, wo es für die Rezipienten wie für die diegetische Welt zu erwarten ist: in der Erzählung von der Menschwerdung und Passion Christi. Wo die Menschwerdung Gottes längst beschlossene und verkündete Sache ist, verdoppelt sich das Moment des Ereignishaften, das der Menschwerdung inhärent ist, in der Entscheidung zur Menschwerdung. Wendepunkt des Heils ist nicht mehr alleine – vielleicht nicht einmal primär – die geschichtliche ‚Mitte der Zeit‘, sondern zugleich auch ihr Anfang (in manchen Erzählungen sogar ein Moment ‚vor der Zeit‘).10 Als nachgehende Boten und als ersehnende Vorläufer vermitteln die Propheten zwischen beiden Momenten. Die drei in ihrem erzählerischen Gestus deutlich voneinander geschiedenen Abschnitte der Erlösung , die jeweils ein eigenes Figurenrepertoire mit einem eigenen narrativen Modus verbinden, erzählen auf je eigene Weise von der Exzeptionalität des Heilsgeschehens. So gelingt es dem Text unterschiedliche Dimensionen des Ereignishaften der Erlösung zu artikulieren: diejenige, über die alle Propheten immer schon gesprochen haben, diejenige, die als erwartbares Wunder exponiert werden kann und diejenige, vor deren Unerwartbarkeit das Erzählen für einen Moment zum Erliegen kommen muss.
Imaginatio, Anachronismus und Heilsgeschichte
Mary Boyle und Annette Volfing
Für die mittelalterliche religiöse Andacht – und die damit verbundenen Literaturformen – stehen Geburt und Passion Christi in einer grundsätzlichen Spannung. Einerseits teilen sie als einmalige historische Ereignisse die Zeit in ein absolutes Vorher und Nachher, und sind damit dem unmittelbaren Zugriff der Gläubigen entzogen. Andererseits durchkreuzt das zyklische Schema des Kirchenjahres die unnachgiebige Linearität dieses zeitlichen Modells ebenso wie die Vorstellung, die Zeit sei immer in der Ewigkeit enthalten und werde nach dem Jüngsten Gericht ihre Relevanz verlieren. Um es mit Hildegard Keller zu formulieren: „Der Christ lebt in einer Spannung zwischen einem ‚Schon‘ und einem ‚Noch-Nicht‘, was eine Art ‚Zeitstreß‘ impliziert.“1
Spannungen dieser Art spiegeln sich typischerweise in Strategien des performativen Gedenkens und der imaginierten Vergegenwärtigung wider, die es den Gläubigen ermöglichen, die wichtigsten biblischen Ereignisse in ihr eigenes Leben oder ihren persönlichen Chronotopos zu assimilieren:2
Das Sich-Vertiefen in eine Passionsszene mittels der imaginatio wird oft auch mit dem Ausdruck ante oculos cordis ponere (vor das innere Auge des Herzens stellen) bezeichnet […]. Zunächst soll sich der Meditierende nach der Lesung des Textes (lectio ) die Szene mittels seiner Einbildungskraft ( imaginatio ) ins Gedächtnis rufen, indem er sich die Geschehnisse mitsamt den beteiligten Personen und dem jeweiligen Ort intensiv vorstellt und verlebendigt.3
In diesem Aufsatz bezieht sich der Begriff ‚Anachronismus‘auf die literarische Gestaltung solcher Vergegenwärtigungsansätze – und nicht etwa auf narrativen Anachronien im Allgemeinen. Das Bedürfnis, sich die biblischen Szenen ins Gedächtnis zu rufen und mittels der imaginatio an ihnen teilzunehmen, kommt in mehreren literarischen Gattungen zum Ausdruck. Henrike Lähnemann hat die Rolle des inneren Auges bei imaginären Pilgerreisen betont.4 Die imaginatio spielt auch bei realen Reisen ins Heilige Land eine entscheidende Rolle. Solche Reisen bieten reichlich Gelegenheit, die Grenzen zwischen biblischer Vergangenheit und mittelalterlicher Gegenwart auszuloten, indem der Reisende einen Zeit-Raum einnimmt, der weder ganz zur einen noch ganz zur anderen gehört. Die Illustrationen zum Reisebericht Arnolds von Harff, dessen Pilgerfahrt zwischen 1496 und 1499 stattgefunden hat, sind zum Teil Darstellungen der Tiere und Menschen der zeitgenössischen Welt und teilweise der heiligen Orte, die auf der Pilgerfahrt besucht worden sind.5 Sieben von den Bildern aus der letzteren Gruppe zeigen Harff selbst in dem historischen Augenblick dargestellt, der dem jeweiligen Ort seine ursprüngliche Bedeutung gab.6 Wenn z.B. Harff und seine Begleiter die Kirche des Heiligen Grabes besuchen, zeigt das Bild, wie er – in der Kleidung des 15. Jahrhunderts – mit den zwei Dieben, die zu beiden Seiten Jesu gekreuzigt worden sind, am Fuße des Kreuzes Christi kniet (Abb. 1). Harff fügt also sein zeitgenössisches Selbst in den Augenblick der Kreuzigung ein und zeigt dadurch, dass er nicht nur die tatsächliche Reise durch den Raum, sondern auch eine imaginäre Reise durch die Zeit gemacht hat. Eine solche Entscheidung, die Passion in der mittelalterlichen Gegenwart darzustellen, bietet auch eine implizite Einladung an den zeitgenössischen Leser oder Betrachter, sich selbst aktiv in diese Szene einzuleben.
Читать дальше