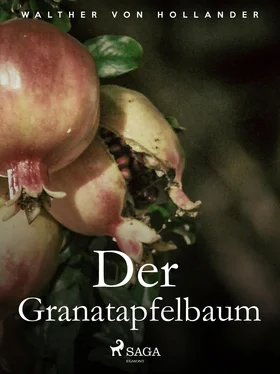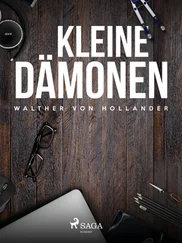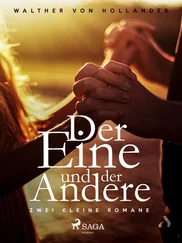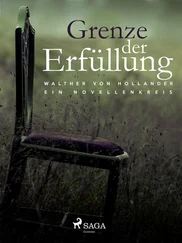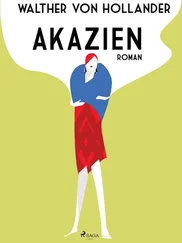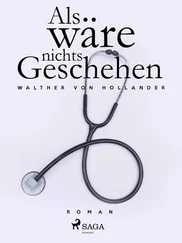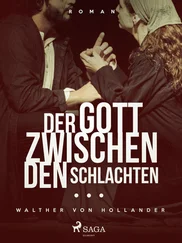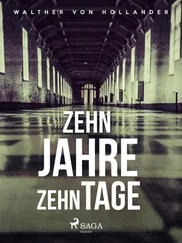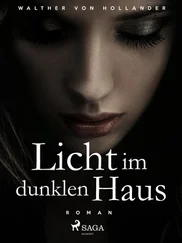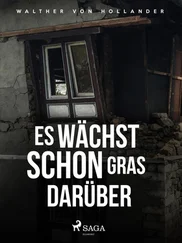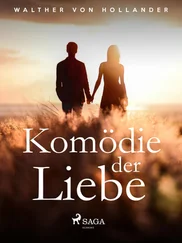Diedrichsen versuchte von seiner verpfuschten Ehe zu berichten, der Ehe mit einer reichen Frau, die so geizig war, daß sie ihn zwang, »Brotarbeit« zu verrichten. Brotarbeit! Er schüttelte sich, als sei Brot etwas Stinkendes, Unflätiges. Sie knechtete den armen Dichter, der ... weiter kam er nicht. Christine erklärte, sie sei bereit, jetzt mit ihm über die holde Kunst zu reden oder gelegentlich auch mal mit ihm spazierenzugehen und die Herrlichkeit der Natur zu genießen, den Singsang des Windes auf dem Mühlenberg und was er sonst wolle. Aber sie sei nicht bereit, mit ihm zusammen seine ehelichen Kümmernisse zu beweinen. »Sie haben eben nie etwas Düsteres und Tragisches erlebt«, sagte der Dichter unwirsch. Christine antwortete freundlich: »Nein, niemals. Ich lächelte mich so durchs Leben und werde mich weiter durchlächeln.«
»Sie haben niemanden zu beklagen, niemanden zu beweinen?« fragte Diedrichsen, der sie nicht verstand. Christine antwortete ernst: »Mein Leben lief hell und munter murmelnd wie ein Bach ... der in die Unterwelt hinabplätschert.«
Mumbo Petersen kam jetzt schwankend an Christines Tisch, setzte sich und schwätzte betrunken auf sie ein. »Sie sind mein Fall«, lallte er, »wenn man Sie laufen läßt, kommen Sie an. Nicht zu viel Temperament, aber sehr viel Atem. Deshalb sind Sie immer zur rechten Zeit da. Und sogar ’n Stück Herz am rechten Fleck.« Er nahm Diedrichsens Bierglas und trank es leer. Dann sprach er weiter: »Daß Sie ein Herz haben, verraten Sie bitte Ihrem Sonnengatten, Herrn Triptolemos, nicht. Der hält nichts von derlei anfälligen Organen.« Und als Christine nicht antwortete: »Weil er kein Herz hat, Ihr Triptolemos, deshalb hat er so ’ne eiserne Konstitution. Kann nicht an Herzweh zugrunde gehen.«
Er stand mühsam auf und schwankte an seinen Tisch zurück.
»Alle lieben Sie«, seufzte Diedrichsen und setzte mühsam eine große Zigarre in Brand. Er hatte seinen Schreibblock vor sich liegen, kritzelte nervös seinen Namen aufs Papier und umgab ihn mit Ballons, mit Blumen, mit Bäumen. »Alle lieben Sie«, wiederholte er hartnäckig. Christine antwortete fröhlich: »Warum sollen sie auch nicht? Ich tue niemanden was. Ich neide niemandem was. Das ist doch Grund genug, geliebt zu werden.«
Diedrichsen dampfte wie ein Totenrichter. Er examinierte sie streng: »Sie beneiden niemanden? Prüfen Sie genau! Niemanden?« Christine sah ihn vergnügt an: »Doch, einen beneide ich: Wyndthausen. Über den haben die Götter alle Gaben ausgegossen.« Diedrichsen hob abwehrend die Hände. Sie solle doch nicht griechisch-hymnisch reden. Nicht von Triptolemos, den sie nach dem Diktat des Stückes, nach Diedrichsens Diktat lieben müsse. Aber bitte keine Verwechslungen: den Herrn Wyndthausen müsse sie nicht lieben. Der sei – das wolle er als alter Freund mal sagen –, Wyndthausen sei gewiß ein Talent, ein Könner von Rang. Aber – Christine wußte schon, was nun kam –: die Kälte. Die Gefahr, sich an dieser Kälte zu entzünden. Wieder eine Warnung. Sie mußte sich hüten, diesen von allen angegriffenen Mann zu verteidigen. Sie hörte nur noch von ferne die Lobsprüche auf ihr Genie und auf ihre Locken, auf ihre Begabung und auf ihre Zierlichkeit, auf ihr Können und ihre tiefblauen, melancholischen Augen, klematisblau ... das hatte er auch bereits herausgefunden. Bekennerische Männer kann man nicht unterbrechen. Sie dachte derweil etwas ganz anderes. Daß es nun endgültig zu spät war abzureisen, daß Persephone nur wegreisen konnte, wenn der Hades sie rief oder, was dasselbe war, wenn Pluto, der Fürst über die Reichtümer und die Unterwelt sie raubte. Es war zu spät, Wyndthausen zu entgehen, wenn er sie haben wollte. Er sie wollte ... welche Demut, was für eine fatalistische Hingabe! Die Entscheidung lag bei Wyndthausen. Seine Entscheidung war das Schicksal, das sie ohne Widerspruch hinnehmen mußte. Wenn sie jetzt allein gewesen wäre, ohne Diedrichsen, dann wäre sie in die Stadt gefahren, ganz einfach. Sie hatte eine schamlose, eine unerträgliche Sehnsucht nach ihm. Und es war ihr ganz einerlei, ob er mit der Psyche dort saß, schäkerte, schmale Zigaretten rauchte und sich ihren Namen für sein Etui erbat. Ganz einerlei. Weil es sich eben nicht nur um Liebe handelte, sondern um Schicksal. Oder machte sie einen pathetischen Schmus um die Tatsache herum, daß sie den Mann haben wollte, daß es ihr unerträglich war, ihn nur auf der Bühne zu umarmen und ihn dann an den Alltag zu verlieren?
Sie stand plötzlich auf. Sie streichelte dem Dichter Diedrichsen über die Wangen. Sie sagte: »Ich freue mich, daß ich einen so treuen Freund gefunden habe. Man braucht viele, viele Freunde.«
Der Dichter schaute mit seinen halbblinden Augen zu ihr hinauf. Er sagte: »Der Angeklagte muß für das milde Urteil dankbar sein.« – »Gute Nacht, Diedrichsen«, sagte sie und lief hinaus, lief hinauf in das schauderhafte Zimmer und schloß die Tür mit Heftigkeit ab. Das wenigstens verlangte das Schicksal nicht von ihr, daß sie auf Wyndthausen wartete.
Drei Tage lang wurden die Szenen der Unterwelt geprobt. Diedrichsen, der Dichter, fand, es seien die tiefsinnigsten, die bedeutendsten Szenen des Stückes. Sie schilderten die langsame Verwandlung der Seele, die den Styx überwindet, den Haßfluß. Dann den Acheron, die Wehströmung. Und Diedrichsens Idee war es, daß Pluto, der Herrscher des Hades, das geraubte Mädchen Kore, die erste Gestalt also Persephones, nicht zwingen konnte, den Haßfluß zu überqueren, den Schmerzfluß zu überwinden, sondern daß sie es freiwillig tun mußte, aus der Erkenntnis heraus, daß nur der zum Vergessen kommen kann, der zuvor durch den Feuerstrom und Tränenstrom gegangen ist. Ingo Keßler, der Bühnenbildner, ein spitznasiges, maus äugiges Männlein mit Existentialistenbart und Fransenfrisur, ein dreißiggjähriges Schattengebilde, wie für den Hades geschaffen, hatte ein großartig-unheimliches Bühnenbild geschaffen. Die fünf Flüsse aus schwarzen Stoffbahnen mit verschiedenfarbigem, phosphoreszierendem Bronzestaub bestreut, der Haßfluß fahlgrün leuchtend, die Wehströmung orangen, der Feuerstrom rot, der Tränenstrom silbergrau und Lethe, das Vergessen, fahl leuchtend, wolkengrau. Charon, der Fährmann, war in schwarzes Segeltuch gekleidet, begleitet von den drei Totenrichtern, die purpurne Kostüme hatten, in der Farbe also des Gerichts. Der Schnitt ihrer Kostüme war dem Charons-Kostüm gleich. Wenn sie die Arme ausbreiteten, wurden es Segel, und die Überquerung der Flüsse ging so vor sich, daß sie mit ihren ausgebreiteten Segelarmen über den Fluß wie auf Booten hinüberfuhren. Das Mädchen Kore in der Mitte, Pluto, den Herrscher, vor sich herschiebend. Bei der Überschreitung aber des Tränenstroms verschwand das Mädchen Kore zwischen den Richtern oder zwischen den Segeln, und in dem Augenblick, in dem Charon am Vergessenfluß, am Lethefluß die Hände Plutos und Kores zusammenfügte, um mit ihnen »heimzufahren«, in das Reich der Schatten, der ewigen Dämmerung, der zeitlosen Ewigkeit, der farblosen Endgültigkeit ... in diesem Augenblick tauchte Kore verwandelt in Persephone auf. Sie hatte das weiße Unschuldsgewand des Mädchens Kore abgelegt und trug das nachtschwarze Gewand der Unterweltskönigin mit einem merkwürdigen Kopfschmuck, einem spitzen, pagodenartigen Turm aus Bronzeglöckchen. Das war ein guter Einfall Diedrichsens, diese Glöckchenkrone Persephones, die über die Unterweltsflüsse hinweg, über Vergessen, Tränen, Feuer, Weh und Haß mit einem zarten Läuten sich abschiednehmend bemerkbar machte. Vielleicht, daß man sie auf der Oberwelt, vielleicht, daß die klagende Demeter sie hörte. Gleichzeitig aber war diese Krone mit ihrem ständigen, leisen Geläute ein Hindernis, je wieder in die Oberwelt emporzutauchen. Denn das Läuten in der Stille der Unterwelt verriet immer, wo sie war und machte die Flucht unmöglich.
Читать дальше