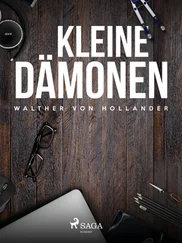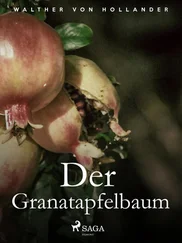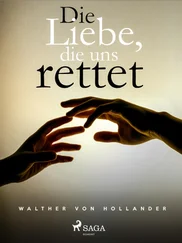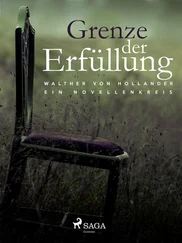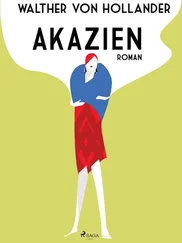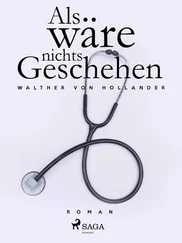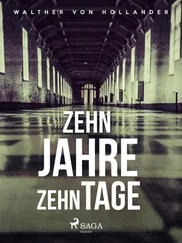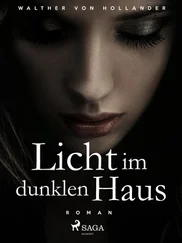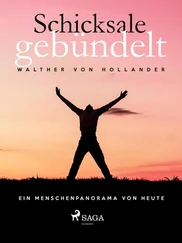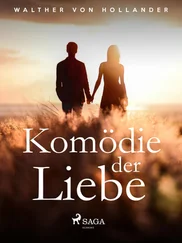Sie sah über seine Schulter hinweg auf die verkohlten Reste des Feuers, auf ein paar Flaschen, die man vergessen hatte zu vergraben, auf ein paar Papiere, die verweht waren, ein paar verwelkte Blumenkränze. Sie löste sich von dem Mann. Sie nahm ihren Wildrosenkranz ab. Ein paar Knospen hatten sich entfaltet. Ein paar Blüten waren schon abgefallen. Achtlos warf sie den Kranz zu den anderen welken Kränzen. Friedhof. Grab. Dachte sie. Nein, grablose Friedhofsecken. Abfallhaufen abseits der Toten. Was für ein Bild für eine Liebende!
Schweigend, Hand in Hand, stiegen sie ins Tal hinunter, in die Stadt. Die Sonne begleitete sie, kam mit ihnen gleichzeitig in die winkligen Gassen. Die Rolläden rasselten hinauf. Die Wasserwagen rumpelten, Feuchte verbreitend, über die Pflaster. Die Bäckereien öffneten. Bäckerjungen, Brötchentüten in den Körben, radelten durch die Straßen. Alles war, wie es immer gewesen war.
Sie zog sich um. Sie ging in die Universität, sie hörte aufmerksam und überwach ihre Vorlesungen, Mittelhochdeutsch, Geschichte, Literatur des 19. Jahrhunderts. Sie schrieb eifrig und fleißig nach. Mitten in einem Satz über Gottfried Keller aber schrieb sie: »Ich liebe Reinhold Wilmer.« Sie starrte diesen Satz an. Strich ihn dick und kräftig wieder aus und schrieb weiter, was der Professor über Gottfried Keller berichtete.
Mittags stieg sie, wie immer, zu den Sonnenbergen hinauf. Es war ein heißer, heller Tag. In den Gärten blühten die Rosen, der letzte Jasmin, die ersten Rittersporne. Sie trat in das Atelier von Theo Grain. Aus der sengenden Hitze kam sie in die Kühle der Nordfenster. »Da ist ja der Ausreißer«, schrie Theo allzu vergnügt, »ein schönes Fest, nicht wahr? Sonnenwend, und es regnete nicht einmal! Ein wahres Wunder.«
Wie immer bereitete sie den Tee. Sie tranken zusammen. Sie schwätzten über das Fest, über Springmeier, den Philosophen, der sich wieder in ein ganz junges Mädchen verliebt hatte, über den spitzbärtigen Silen, den bedeutenden Verleger, der wie ein gütiger, antiker Gott das Fest gelenkt hatte. Sie setzte sich wieder in den geblümten Sessel. Sie hatte die blutrote Bluse an und den weißen Pikeerock, in dem er sie malte. Sie nahm die gewünschte Stellung ein, die rechte Hand gegen die Schläfe gestützt. Sie sah freundlich lächelnd zu Theo Grain hinüber, der, einen Pinsel im Mund, einen in der Hand, vor sich hinbrabbelte, abwechselnd über das Bild, über das Fest, über Lucia, die an jedem Tage eine andere sei und niemals einzufangen. Mitten in ein paar Ausrufe des Malers hinein sagte sie sehr ruhig: »Ich liebe dich nicht mehr, Theo.«
Theo nahm den Pinsel aus dem Mund, starrte sie prüfend an und kommandierte: »Etwas mehr rechts den Kopf. Noch mehr. So ist’s gut. Und mehr in die Weite geschaut. Ja, so ist es richtig.«
Zehn Minuten malte er weiter, indem er sich ab und zu mit Grunztönen beschimpfte oder belobte. Endlich legte er Pinsel und Palette weg. Er trat zu ihr, legte ihr lächelnd die Hand auf die Schulter und sagte: »Hab’s gar nicht geahnt, daß ich die Ehre hatte, von dir geliebt zu werden. Na ... zu spät ist immer noch besser als gar nicht, Undine.« Er zog sich einen kleinen Hocker heran, legte ihr die Hand auf den Arm und sagte: »Undine ... so hab’ ich dein Bild genannt, schon lange. Wasserwesen, Elementargeist ohne die unsterbliche Seele. Die kriegt Undine erst durch Vermählung mit einem irdischen Mann.« Und sehr zärtlich setzte er hinzu: »Es tut weh, Undinchen, glaub’s mir, wenn man eine unsterbliche Seele bekommt.« Er stand auf, setzte noch ein paar Pinselstriche auf das Bild, schüttelte den Kopf und sagte: »Es ist mir nicht gegeben, dir die Seele einzuhauchen. Fertig.« Er nahm das Bild von der Staffelei. Stellte es neben Lucia und sagte ernst: »Schenk’ ich dir als Andenken an dein nymphisches Leben.« Sie stand auf. Sie sagte: »Theo ... ich weiß es ja gar nicht. Kann sein, ich könnte dich doch lieben.«
Er nahm sie um die Schulter, führte sie zum Ausgang und sagte: »Könnte, könnte, Undinchen. Leb wohl!« Er drückte ihr das Bild in die Hand, und sie ging, es vorsichtig am Keilrahmen haltend, durch die Straßen, die noch heißer geworden waren. Die Menschen lächelten über das junge Mädchen, das sich selbst durch die Gassen trug. Sie merkte es nicht. Sie grübelte. Sie wußte nicht, ob sie etwas gewonnen oder verloren hatte. Verloren gewiß etwas. Den heiteren, zärtlich-zarten Theo Grain. Aber gewonnen? Die Liebe zu Reinhold Wilmer war ja auch schon vorbei.
1944, in der Nacht vom 26. zum 27. Januar, hatte Lucia von Tweeren begonnen, über die zwanzigjährige Lucia Bernhöven zu schreiben, über das vergangene Ich also, das schwesterliche Schatten-Ich, das neben ihr saß und ihr die schreibende Hand führte. Jetzt, da sie das Geschriebene überlas, war es der 27. Januar, 10 Uhr etwa. Es war wieder sehr kalt geworden. Draußen auf dem See, der der Plüggen hieß, tummelten sich die Dorfkinder mit Schlitten und Schlittschuhen. In ihre dünnen, kreischenden Stimmen, die heraufklangen, mischte sich die herrische Befehlsstimme der kleinen Bettine, ihrer Tochter. Die Sonne schien ins Fenster, wärmte die Hände. Sie starrte auf die schwarzen Buchstaben. War es richtig, war es wahr, was sie geschrieben hatte? Gab es die überschwengliche, die das Herz sprengende Liebe von drei ewigen Minuten, oder war alles durch die Erinnerung versüßt, durch die Erfahrung zu spöttisch angeblickt, durch die Feuer, durch die sie hindurchsah, falsch, bengalisch beleuchtet? Kann man sich überhaupt erinnern, und das heißt doch, in die Vergangenheit zurücktreten, das dazwischen Erlebte ablegen, oder zeigt die Erinnerung nur das, was nach dem Erlöschen der Feuer noch leuchtet?
Der 27. Januar. Sie lächelte. Sie hörte die – in Bettine, der Achtjährigen, auferstandene – etwas schnarrende, schneidige Stimme ihres Vaters: »Am heutigen Tag, dem Geburtstag Seiner Majestät unseres allergnädigsten Kaisers und Herrn, Wilhelms II.«
Sie stand am Rande eines Exerzierfeldes, zwölf Jahre alt, ein Barett aus Schwanenfedern auf dem Kinderkopf, ein pelzbesetztes Plüschjäckchen über den Kinderschultern. Die Sonne schien. Die Helme der Soldaten blitzten. Es blitzten die Degen der Offiziere. Der Vater, Bernard Bernhöven, Major und Bataillonskommandeur, saß auf seinem Rappen. Der Adjutant, Leutnant von Scheffke, auf einem Schimmel hinter ihm, die silberne Adjutanten-Schärpe »auf Taille«. Und weiter die schnarrende Stimme. Hochrufe. Kommandos. Dröhnender Parademarsch. Das kleine Mädchen in dem Schwanenbarett stand dicht hinter dem Vater, der die Parade abnahm, und die fünfhundert Männer, die mit ausgestreckten Beinen vorbeistampften, blickten zu ihm auf. Fünfhundert Männer. Warum taten sie das? Der Vater sah sehr stattlich aus, wenn er seinen Degen vor der Fahne senkte. Aber er war nicht immer so großartig. Sie schaute die Mutter an. Die machte ihr undurchdringliches Kirchengesicht. Das feierliche Gesicht. Die Kapelle schwenkte jetzt ein. Die Trompeten blitzten in der Wintersonne. Die Stiefelsohlen der Soldaten krachten. Die Kinder rasten hinter der Kapelle drein. Nur Lucia blieb Hand in Hand mit der Mutter zurück. »Warum weinst du?« fragte die Mutter streng. »Man weint nur, wenn man allein ist.« Und Lucia, die Zwölfjährige, antwortete: »Ich bin ja allein.« Sie standen tatsächlich allein auf dem Exerzierfeld. Ganz fern bumsten noch die Pauken. Dann war alles still. »Komm«, sagte die Mutter. Und sie gingen durch die beflaggte Stadt, um den See herum zur grauen Villa der Bernhöven hinauf. Ein Ritter mit Windfahne stand auf dem Dach. Der Wind kam von Osten.
Aber zurück nach Jena. Ungefähr – wenn man auf die Wirklichkeit kommen will, muß man der Reihe nach erzählen. Muß man? Gibt’s die Reihenfolge? Das ist schwer zu sagen. Mal treten die einen Jahre nah an uns heran, mal die anderen, und mal ist es ein Gemisch von Jahren und Erlebnissen, eine Kette, und man denkt, man hat den Faden in der Hand, das Leitseil (oder das Leid-Seil?), an dem man über Schroffen durch den Nebel getastet ist, ohne abzustürzen. Daß man vielleicht doch aus einem Grundmotiv heraus gehandelt hat, von einem primum movens getrieben. Ich kann das primum movens nicht entdecken – schrieb sie jetzt nieder. Die Verwirrungen, in die ich getrieben wurde, entwirrten sich »ohn’ mein Verdienst und Würdigkeit«. Ich entkam. Geschlagen, zerschlagen oft, aber ich entkam.
Читать дальше