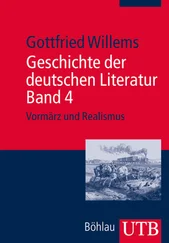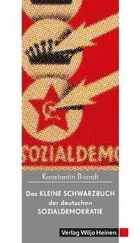Der Auseinandersetzung mit Kant entsprangen Schillers Gedanken Über Anmut und Würde (1793), 21eine vorläufige Theorie des Schönen, die er 1795 in einen gesellschaftspolitischen Rahmen stellte und, seinem Wohltäter zum Dank, in einer Reihe von 27 Briefen an den Prinzen von Augustenburg niederlegte. Diese Abhandlung Über die ästhetische Erziehung des Menschen gilt als pädagogische Programmschrift der deutschen Klassik; ihr Kernsatz lautet: »[…] es gibt keinen andern Weg, den sinnlichen Menschen vernünftig zu machen, als daß man denselben zuvor ästhetisch macht.«
In dem Geburtstagsbrief, der 1794 die Freundschaft mit Goethe begründete, hatte Schiller Goethes intuitiven dichterischen Zugriff von dem eigenen spekulativen Zugriff unterschieden. Die Abhandlung Über naive und sentimentalische Dichtung (1795–96) weitet diesen Wesensunterschied zu einer dichterischen Typenlehre aus. Danach ist der Dichter entweder naiv (bzw. intuitiv) mit der Natur verbunden und erstrebt als Realist unbefangen »möglichst vollständige Nachahmung des Wirklichen«, oder er versucht sentimentalisch (bzw. spekulativ) seine durch Kultur und Zivilisation verursachte Entfremdung von der Natur zu überwinden, indem er als Idealist alles Wirkliche auf eine Idee bezieht. Dieser Unterschied ist leicht zu begreifen, wenn man Goethes und Schillers Lyrik miteinander vergleicht. Während Goethe im wesentlichen den im Sturm und Drang aufgenommenen volkstümlich-liedhaften Ton fortentwickelte, bewegte sich Schiller als Gedankenlyriker vorzugsweise auf philosophischem Boden. Über der Anschauung steht in seinen Gedichten immer die Idee. 22
Das zeigen auch die Balladen, die Schiller 1797–98 im Wettstreit mit Goethe schrieb. 23– Griff Goethe gern magisch-dämonische Elemente der volkstümlichen Naturballade auf, so geht Schiller in seinen Balladen jeweils von einer Idee aus, die sich dann oft in lehrhaften, zumindest rhetorischen Sentenzen 24ausdrückt. Statt des ursprünglichen Liedtones bevorzugt Schiller eine dramatische Grundstruktur mit klarer Rollenverteilung, überraschenden Wendungen und dramatischer Zuspitzung der Handlung. Diese Ideenballaden, die sich weit von der herkömmlichen Volksballade entfernen, erfreuten sich besonderer Beliebtheit im Deutschunterricht der Schulen, so dass sie nicht selten zerlesen und dann auch parodiert wurden.
Nach der theoretischen Beschäftigung mit dem Schönen, dem Guten und dem dichterisch Wahren kehrte Schiller von der Geschichtsschreibung zur Dramendichtung zurück. Über der Prosadarstellung der Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs war er immer stärker vom Charakter und Schicksal des kaiserlichen Generals Albrecht von Wallenstein gefesselt worden, jenes berühmten Feldherrn, der in geheimen Verhandlungen mit den Feinden stand und 1634 in Eger von den eigenen Soldaten ermordet wurde. – Ob Wallensteins List dem Kaiser, dem Reich oder nur ihm selbst nutzen sollte, konnte die Geschichtswissenschaft bis auf den heutigen Tag nicht klären, denn:
Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt
Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte.
Gerade diese Zwielichtigkeit aber zog Schiller an. Nach der theoretischen Erörterung Über naive und sentimentalische Dichtung wollte er, der bisher nur idealistische Figuren auf die Bühne gebracht hatte, mit einem realistischen Helden beweisen, wie viel auch ein sentimentalischer Dichter an Wirklichkeit zu geben vermag. 25
In über vierjähriger Arbeit schrieb Schiller die dramatische Trilogie 26mit den Teilen Wallensteins Lager (1798), Die Piccolomini (1799) und Wallensteins Tod (1799).
Wallenstein, der uneingeschränkte Befehlshaber des kaiserlichen Heeres, verabsäumt über verwerflichen Gedanken an Eigennutz und Verrat pflichtgemäß-sittliches Handeln. Durch sein Zaudern und durch zugelassenen Betrug seiner Nächstuntergebenen verliert er seine Handlungsfreiheit und wird zum Spielball derer, über die er zu verfügen gedachte. Betroffen fragt er sich in seinem großen Monolog 27:
Wärs möglich? Könnt ich nicht mehr, wie ich wollte?
Nicht mehr zurück, wie mirs beliebt? Ich müßte
Die Tat vollbringen , weil ich sie gedacht , […]. (Tod , I, 4.)
Sein jugendlicher Freund Max Piccolomini verweist Wallenstein auf die idealistische Entscheidungsfreiheit:
Und wärs zu spät – und wär es auch so weit,
Daß ein Verbrechen nur vom Fall dich rettet,
So falle! Falle würdig, wie du standst.
Max selbst bewahrt sich auf diese idealistische Weise im Untergang die Freiheit, 28während den Realisten Wallenstein in tragischer Ironie (vgl. Kap. 8, Anm. 8) die gedungenen Häscher im Schlaf ereilen.
Der Erfolg des Wallenstein auf dem Weimarer Hoftheater und die Absicht, auch bei künftigen Proben eng mit Goethe zusammenzuarbeiten, veranlassten Schiller, mit seiner Familie von Jena nach Weimar zu ziehen. Ein halbes Jahr nach dem Umzug war die Tragödie Maria Stuart (1800) fertig. – Wieder ein historisches Drama, das »das Realistische zu idealisieren« sucht; doch diesmal nicht in chronologischer Entfaltung eines zur Trilogie ausufernden Stoffes, sondern analytisch 29und knapp, mit strengem tektonischen Aufbau: 30
Der erste Akt zeigt Maria Stuart, die schöne schottische Königin, die, früh verwitwet, den Mörder ihres zweiten Gatten geheiratet hat und, vom Thron verjagt, nach England flüchtete, wo ihr als Thronrivalin Elisabeths im Kerker das Todesurteil droht. Mortimer, der Neffe ihres redlichen Bewachers, ein heimlicher Konvertit, möchte die katholische Königin befreien und ihr zur Macht verhelfen.
Der zweite Akt zeigt Elisabeth an der Seite ihres Geliebten Lord Leicester (sprich [’lestə]). Sie vertröstet eine Gesandtschaft des französischen Königs, der um ihre Hand anhält, und hört ihren Staatsrat zum Urteil über Maria Stuart. Danach beauftragt sie insgeheim den jungen Mortimer, das schlechtbegründete Todesurteil an Maria durch Meuchelmord zu vollstrecken. Mortimer erklärt sich zum Scheine bereit und verrät Elisabeths Anschlag und seine eigenen Pläne Lord Leicester, an den ihn Maria verwiesen hatte.
Der dritte Akt bringt mit der durch Lord Leicester herbeigeführten Begegnung der beiden Königinnen den Höhepunkt. Durch unbarmherzige Härte fordert Elisabeth Marias Stolz heraus. Statt zu Versöhnung kommt es zu wechselseitigen Beleidigungen, wobei Maria in tragischer Ironie über Elisabeth triumphiert.
Der vierte Akt zeigt Königin Elisabeths Ratlosigkeit. Mortimers und Leicesters Pläne zur Befreiung Marias sind entdeckt. Leicester rettet sich mit knapper Not, indem er den Mitverschworenen Mortimer verrät und für Marias Todesurteil plädiert. Elisabeth unterschreibt das Urteil, jedoch ohne den Sekretär, dem sie es übergibt, anzuweisen, wie er mit dem Blutbefehl verfahren soll.
Im letzten Akt erscheint Maria zu sittlicher Freiheit geläutert. Sie ist bereit, das unverdiente Todesurteil als Sühne für die Schuld am Tode ihres zweiten Gatten anzunehmen. Sie geht im äußeren Glanz ihrer Schönheit und mit der Würde ethischer Selbstüberwindung zum Schafott. Elisabeth, die zum Schein ihrer Unschuld jenen Sekretär, dem sie das Todesurteil überließ, bestraft, wird von ihrem einzigen getreuen Rat verlassen. Und als sie nach ihrem Geliebten fragt, heißt es: »Der Lord lässt sich / Entschuldigen, er ist zu Schiff nach Frankreich.«
In der »romantischen« 31Tragödie Die Jungfrau von Orleans (1801) steigert Schiller das historische Läuterungsdrama zur Legende; denn hier geht es nicht mehr nur um eine weltliche Sünderin, die sich sterbend zu majestätischer Würde erhebt, sondern um eine Heilige, die ihre Reinheit noch gegen die sanfte Regung der Liebe behauptet.
Jeanne d’Arc (historisch 1412–1431), die Tochter eines französischen Bauern, fühlt sich berufen, Frankreich im Hundertjährigen Krieg (1339–1453) gegen England zum Sieg zu verhelfen. Voraussetzung für die Erfüllung dieses übermenschlichen Auftrags ist jedoch, dass sie jeder persönlichen Neigung entsagt. – Johanna ist dazu bereit und siegt mit dem Schwert in der Hand, bis sie beim Anblick Lionels, den sie im Kampf überwunden hat, in einer Anwandlung von Liebe die Erfordernis ihrer himmlischen Sendung vergisst. Sie lässt den Feind entkommen, gerät darauf selbst in englische Gefangenschaft und wird bei ihren Landsleuten vom eigenen Vater der Hexerei bezichtigt. – Endlich sühnt sie die unerlaubte Rührung ihres Herzens durch den Opfertod für ihr Vaterland in einer letzten siegreichen Schlacht.
Читать дальше