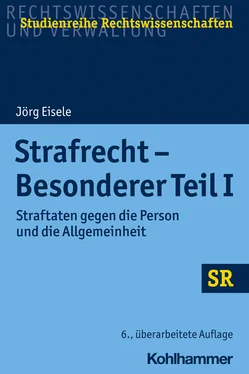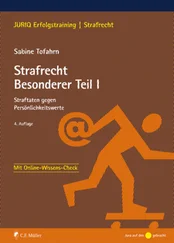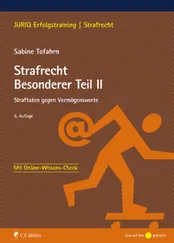243 a)Nr. 2 setzt anders als Nr. 1 bereits das Bestehen einer hilflosen Lagevoraus. Im Übrigen ist die hilflose Lage aber wie bei Nr. 1 auszulegen 693.
244 b)Das Im-Stich-Lassenist zunächst verwirklicht, wenn sich der Garant räumlich entfernt.
Bsp.:Krankenschwester T verlässt das Zimmer des schwerkranken Patienten O (Garantenstellung kraft tatsächlicher Übernahme); T verlässt den Unfallort, nachdem er den O mit seinem PKW bei einem Unfall schwer verletzt hat (Garantenstellung aus Ingerenz); Mutter und Vater lassen ihr Kleinkind allein, um ins Kino zu gehen (Garantenstellung kraft Gesetz, § 1626 Abs. 1 BGB, sowie kraft familiärer Verbundenheit).
245Darüber hinaus werden aber auch Fälle erfasst, in denen der Garant das Opfer lediglich im Stich lässt, ohne sich dabei räumlich zu entfernen 694.
Bsp.:Die über den Nachtdienst verärgerte Krankenschwester betrinkt sich oder schläft in ihrem Raum und vernachlässigt dadurch Patient O, wodurch dieser in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung gerät.
246Einbezogen sind letztlich auch Fälle, in denen das Im-Stich-Lassen noch nicht im räumlichen Entfernen vom Opfer gesehen werden kann, sondern der Täter seiner Beistandspflicht erst dadurch nicht nachkommt, dass er nicht mehr zum Opfer zurückkehrt 695.
Bsp.:Die Eltern verlassen das Kleinkind O, um ins Kino zu gehen. Nach Ende der Vorstellung fassen sie spontan den Entschluss, nicht zurückzukehren, sondern über das Wochenende wegzufahren.
3.Abgrenzung von Nr. 1 und Nr. 2
247In den Fällen des räumlichen Verlassens können sich Abgrenzungsprobleme zwischen § 221 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2stellen. Dabei ist auch hier von entscheidender Bedeutung, wie man das Merkmal der hilflosen Lage bei Nr. 1 versteht 696.
Bsp.:O unternimmt mit Bergführer T eine Bergtour. Nach einem heftigen Streit steigt T einfach ohne ihn ab, wodurch O in dem ihm unbekannten Gelände in konkrete Lebensgefahr gerät.
248Ein Versetzen in eine hilflose Lage i. S. d. Nr. 1 durch das Unternehmen der Bergtour kann man richtigerweise nicht annehmen. Denn insoweit ist die objektive Zurechnung zu verneinen, weil eine freiverantwortliche Willensentscheidung und damit eine Selbstgefährdung des O vorlag. Es stellt sich dann weiter die Frage, ob im Zurücklassen des O das Versetzen in eine hilflose Lage zu sehen ist. Auch dies sollte verneint werden, weil sich O zu diesem Zeitpunkt bereits in einer hilflosen Lage befand, in die er durch eine eigenverantwortliche Entscheidung geraten ist 697. Für die Annahme einer hilflosen Lage ist nämlich maßgebend, dass sich O nicht mehr aus eigener Kraft vor der drohenden Lebensgefahr schützen konnte, vielmehr bereits der Beistand des T erforderlich war. Einschlägig ist dann jedoch Nr. 2. O befand sich in einer hilflosen Lage und T unterließ den notwendigen Beistand, obwohl er Garant kraft tatsächlicher Übernahme war. Würde man anders entscheiden und auf diesen Fall die Nr. 1 anwenden, würde man vor allem das Erfordernis der Garantenstellung in Nr. 2 umgehen 698.
4.Eintritt einer konkreten Gefahr
249Weitere tatbestandliche Voraussetzung für § 221 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 ist, dass der Täter die hilflose Person durch die Tathandlung einer konkreten Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung aussetzt.
250 a)Eine konkrete Gefahrist gegeben, wenn die Tathandlung über die ihr innewohnende latente Gefährlichkeit hinaus zu einer kritischen Situation für das geschützte Rechtsgut führt. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung muss – was aufgrund einer objektiv nachträglichen Prognose zu beurteilen ist – die Sicherheit einer bestimmten Person so stark beeinträchtigt werden, dass es nur noch vom Zufall abhängt, ob das Rechtsgut verletzt wird oder nicht 699.
Klausurhinweis:Der Begriff der konkreten Gefahr wird in vielen zentralen Tatbeständen – §§ 113 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2, 218 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2, 225 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2, 239 Abs. 3 Nr. 2, 250 Abs. 1 Nr. 1c, Abs. 2 Nr. 3b, 306a Abs. 2, 306b Abs. 2 Nr. 1, 315 Abs. 1, 315a Abs. 1, 315b Abs. 1, 315c Abs. 1, 315d Abs. 2 – verwendet. Die genannte Definition gilt dort entsprechend („Baukastenprinzip“).
251 b)Problematisch ist, was unter dem Begriff der schweren Gesundheitsschädigungzu verstehen ist. Unbestritten ist zunächst, dass höhere Anforderungen als bei einer (einfachen) Gesundheitsschädigung i. S. d. § 223 Abs. 1 Var. 2 zu stellen sind. In jedem Falle kann man darunter solche gesundheitlichen Folgen subsumieren, die entweder in § 226 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ausdrücklich genannt sind 700oder jedenfalls mit den dort genannten Gesundheitsschäden einen vergleichbaren Schweregehalt aufweisen 701. Aber auch die konkrete Gefahr einer Gesundheitsschädigung, die unterhalb der Schwelle des § 226liegt, wird richtigerweise erfasst. Eine schwere Gesundheitsschädigung liegt daher auch dann vor, wenn das Opfer in eine ernste, langwierige Krankheit verfällt, eine dauernde oder langwierige schwerwiegende Beeinträchtigung der Gesundheit 702, der Arbeitskraft oder anderer körperlicher Fähigkeiten oder eine nachhaltige Beeinträchtigung der physischen oder psychischen Stabilität 703gegeben ist. Dies kann der Fall sein, wenn intensivmedizinische Maßnahmen oder umfangreiche und langwierige Rehabilitationsmaßnahmen zur Wiederherstellung der Gesundheit bzw. zur sonstigen Beseitigung der Tatfolgen erforderlich sind 704. Dabei ist auch die individuelle gesundheitliche Konstitution des Opfers zu berücksichtigen 705. Dasselbe gilt für die persönlichen Verhältnisse des Opfers, die – wie etwa der Beruf – für das Vorliegen einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Arbeitskraft maßgeblich sein können 706.
252 c)Erforderlich ist ferner ein spezifischer Gefahrzusammenhangzwischen Tathandlung und Gefahrerfolg, d. h. der Eintritt der konkreten Gefahr muss gerade auf der der Tathandlung eigentümlichen Gefährlichkeit beruhen.
Bsp.: 707T nimmt dem betrunkenen O in einer eiskalten Winternacht seine Daunenjacke weg und setzt diesen am Straßenrand ab. Nur durch Zufall wird O von einem Passanten aufgefunden und vor dem Kältetod gerettet. – T macht sich nach § 221 Abs. 1 Nr. 1 strafbar, da die Gefahr des Kältetodes die typische Gefahr der Tathandlung ist. Anders wäre der Fall zu beurteilen, wenn die Todesgefahr darauf beruht, dass O von Räuber R überfallen wird und durch Messerstiche schwer verletzt wird. Denn hier hat sich nicht die typische Gefahr der Aussetzung, sondern die allgemeine Gefahr, Opfer eines Raubüberfalls zu werden, verwirklicht.
253 d)Wichtig ist im Übrigen, dass man zwischen der hilflosen Lage einerseits und der konkreten Gefahr andererseits unterscheidet 708. Dies hat vor allem Bedeutung für Fälle der Nr. 2. Besteht aufgrund der hilflosen Lage, in der der Täter das Opfer im Stich lässt, bereits eine konkrete Gefahr, so kann Nr. 2 nur noch dann erfüllt sein, wenn entweder diese konkrete Gefahr gesteigert wird 709oder durch das Im-Stich-Lassen eine andere konkrete Gefahr eintritt 710. Denn Voraussetzung für die Anwendung des Tatbestandes ist, dass sich die konkrete Gefahr gerade aus der hilflosen Lage entwickelt 711.
Bsp.:Der kranke O befindet sich in der Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung. Krankenschwester T lässt ihn im Stich, wodurch sich der Zustand deutlich verschlechtert und er in die Gefahr des Todes gerät. Da sich die bereits bestehende Gefahr durch das Im-Stich-Lassen weiter steigert, ist der Tatbestand des § 221 Abs. 1 Nr. 2 verwirklicht.
Читать дальше