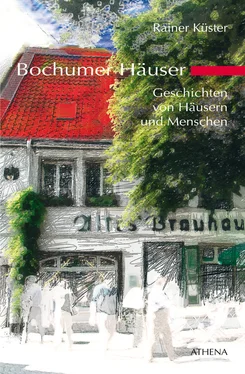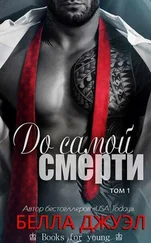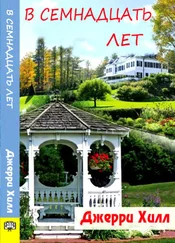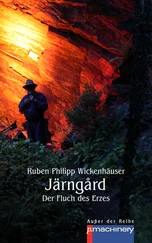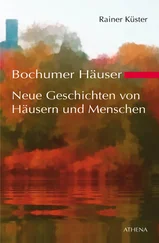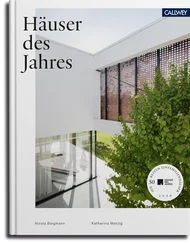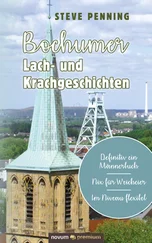Als sie ziemlich genervt in Herberts Haus ankamen, musste er noch einen Patienten aufsuchen. Rosemarie war für ein paar Augenblicke allein. Alles brach jetzt über ihr zusammen. Sie weinte bitterlich, weil man sie genötigt hatte, in eine Welt zu reisen, die ihr völlig fremd war, weil sie einen Mann heiraten sollte, den sie nur aus seinen Briefen kannte, und weil die Alternative im Grunde keine war.
Während der Trauungszeremonie musste Herbert sie anstoßen, damit sie überhaupt das »Oui« herausbrachte. Zu Hause machten sie hinterher eine Flasche Champagner auf. Aber schon zehn Minuten später zog sich Rosemarie in ihr Zimmer zurück, schloss sich ein und blieb dort mehrere Tage lang. Sie konnte nicht einmal ihre Eltern anrufen, da sie wusste, dass die ohnehin mit ihrem afrikanischen Abenteuer nicht einverstanden waren. Aber Herbert war sehr geduldig mit ihr und blieb es auch bis zu dem Tag, an dem in Stanleyville ein gewaltiges Gewitter niederging, ein Umstand, der Rosemarie in Angst und Schrecken versetzte. Herbert muss es damals irgendwie gelungen sein, sie zu trösten, und das war dann auch der eigentliche Anfang ihrer Ehe.
Das Klima in der neuen Heimat war feucht und heiß. Rosemarie verbrachte ganze Tage in der Badewanne, um sich abzukühlen, aber oft gab es gar kein Wasser. So richtig kochen konnte sie immer noch nicht, und wenn sie es versuchte, war die Hitze in der Küche unerträglich. Auch die politische Situation des Ehepaars Molser war schwierig, denn obwohl sie Juden waren, galten sie immer noch vor allem als Deutsche. Auch die Nachrichten, die Rosemarie von zu Hause erhielt, waren deprimierend. Zwei weitere jüdische Familien waren inzwischen in das Elternhaus in der Bochumer Parkstraße gezogen. Alle versuchten sie, noch irgendwie aus Deutschland rauszukommen, aber man konnte keine Visa erhalten.
Ganz schwierig wurde es für die Molsers, nachdem Deutschland am 10. Mai 1940 die Westoffensive begonnen hatte und deutsche Truppen in Holland und Belgien einmarschiert waren. Schon am nächsten Tag wurde Herbert verhaftet und eingesperrt. Dass sie Juden waren, zählte in Belgisch-Kongo nicht. Wie damals in England galten sie auch hier als Feinde, als »enemy aliens«.
Es folgte eine Zeit des Hungers für Rosemarie. Nach sechs schwierigen Wochen wäre es ihr fast gelungen, Herbert im Gefängnis zu besuchen, aber er war nicht mehr da. Zum ersten Mal in ihrem Leben wurde Rosemarie ohnmächtig. Als sie erwachte, sagte man ihr, Herbert lebe jetzt in einem Lager für Kriegsgefangene und sie könne dort zu ihm ziehen. Wieder blieb ihr gar keine Wahl, denn sie hatte kein Geld und nichts mehr zu essen. Da sie keinen Koffer besaß, packte sie, was irgendwie von Wert war, in ein Bettlaken und zog in das Gefangenenlager.
Dort lebten die beiden in einer kleinen Hütte, deren Dach vergammelt war. Vom frühen Abend bis zum nächsten Morgen um acht wurden sie in der Hütte eingesperrt. Die Hitze war unerträglich. Sie hatten nur eine schmale Liege, so dass einer von ihnen immer auf dem Boden schlafen musste. Essen gab es nicht. Sie kochten sich eine schreckliche Suppe aus Blättern, Öl und irgendwelchen afrikanischen Wurzeln und ernährten sich wochenlang davon. Umgeben waren sie in dem Lager von anderen deutschen Gefangenen, die sie stets spüren ließen, dass sie Juden waren. Sie wurden tyrannisiert und lebten in ständiger Todesangst.
Nach dem Kriegseintritt Italiens wurde ein zweites Gefangenenlager eingerichtet, und man forderte Herbert auf, als medizinischer Aufseher für beide Lager tätig zu sein. Zwei Monate später erkrankte Rosemarie an Blinddarmentzündung. Der Chirurg, der sie operierte, war ein übler Metzger. Rosemarie infizierte sich infolge der Operation so massiv, dass sie später keine Kinder bekommen konnte. Zwei Monate blieb sie im Hospital, wo Herbert sie nicht einmal besuchen durfte. Als sie in das Lager zurückkehrte, wog sie nur noch 90 Pfund.
Eine Schwester vom Roten Kreuz sorgte dann dafür, dass die Molsers in den Süden des Kongo verlegt wurden, wo es nicht ganz so heiß war. Nach wochenlangen Strapazen landeten sie in Biano, einem kleinen Ort bei Elizabethville, dem heutigen Lubumbashi. Dort wohnten sie im selben Haus mit einem österreichisch-schweizerischen Paar, die schlimme Antisemiten waren. Sie beschimpften die Molsers und bestahlen sie. Eines Tages lotsten sie Rosemarie aus dem Haus und fütterten derweil ihre Hunde mit dem Essen der Molsers, das für eine ganze Woche reichen sollte. Ein Mitarbeiter vom Roten Kreuz erlöste sie aus dieser unwillkommenen Hausgemeinschaft. Als er hörte, dass Herbert Arzt war, versuchte er zu helfen. Im Mai 1941 wurde Herbert Chefarzt eines Krankenhauses mit 120 Betten in Elizabethville. Das Schlimmste lag jetzt hinter ihnen.
Inzwischen hatten Rosemaries Eltern es doch noch geschafft, über Spanien und Portugal nach Amerika zu emigrieren. Wahrscheinlich waren sie die letzten Juden gewesen, die noch aus Bochum, vielleicht sogar aus Deutschland herausgekommen waren. Aber es gab noch eine weitere große Sorge. Herberts Eltern lebten in Berlin in einem sogenannten Judenhaus, das hoffnungslos überfüllt war. Sie hatten kein Geld mehr, und Herbert konnte mit seinen Eltern nur mit Hilfe des Roten Kreuzes korrespondieren. Im Jahre 1942 erhielt er eine letzte Nachricht von ihnen. Dann war alles still.
Als im Mai 1945 der Krieg zu Ende war, mussten Rosemarie und Herbert eine Entscheidung treffen. Berlin lag in Trümmern, und es gab noch immer keine Nachricht von Herberts Eltern. Schließlich entschieden sich die beiden Molsers für die USA. Sie wollten auch nach Amerika emigrieren, wie Rosemaries Familie. Aber sich aus dem Kongo zu verabschieden war fast so schwierig wie vor sechs Jahren hineinzukommen. Irgendwie gelang es ihnen im Februar 1946, eine DC-4 zu besteigen, eine Propellermaschine, die immerhin drei Tage brauchte, um sie bis nach New York City zu bringen.
Dort gab es ein Wiedersehen mit Rosemaries Mutter und den beiden Schwestern. Aber der Vater war im Oktober 1944 in der Fremde verstorben. Dr. Julius Marienthal, der einer Bochumer Kaufmannsfamilie entstammte, die seit 200 Jahren in Westfalen lebte, hatte sich in der neuen Welt nicht mehr zurecht gefunden. Der national gesinnte Mann, der im Ersten Weltkrieg als EK I- und EK II-Träger seinem Kaiser treu gedient hatte, der einst in Bochum Vorsteher einer erfolgreichen Anwaltskanzlei gewesen war, hatte in Amerika nicht mehr Fuß fassen können. Bevor er starb, hatte er sich in New York noch als Arbeiter am Fließband, als Hauslehrer und sogar als Butler versucht, um Geld für seine Familie zu verdienen.
Auch über das Schicksal von Herberts Eltern erhielten die Molsers in New York nun traurige Gewissheit. Als sie in Berlin von den NS-Behörden das Schreiben bekommen hatten, sie sollten sich auf ihre Deportation einrichten, sahen sie für sich keinen anderen Ausweg als sich umzubringen. Einerseits war dies eine erschütternde Nachricht, andererseits glaubten Rosemarie und Herbert, dass seine Eltern die richtige Entscheidung getroffen hatten. Auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee erinnert heute eine Grabstelle an das Ehepaar.
Herbert musste sich noch einmal einer zusätzlichen medizinischen Ausbildung unterziehen, um überhaupt in Amerika als Arzt praktizieren zu dürfen. Rosemarie arbeitete achtzig Stunden in der Woche als Kinderfrau in Privathaushalten, später auch in einem Altenheim. Eine Wohnung hatten sie in Washington Heights gefunden, dem Stadtteil im nördlichen Manhattan, wo sich viele deutsche Juden angesiedelt hatten. Nach den strapaziösen Jahren in Belgisch-Kongo, im Herzen der Finsternis, genossen sie trotz harter Arbeit das aufregende kulturelle Leben in der amerikanischen Metropole.
So verging das erste Jahr in der Freiheit Amerikas. Dann zogen sie weiter nach Rochester, in die Stadt am Ontario-See, im Nordwesten des Staates New York, wo sie sich endgültig niederließen. Anfangs kamen noch keine Patienten in Herberts Praxis; in dieser Zeit machte er Hausbesuche, die ältere Ärzte nicht mehr übernehmen wollten. Wenn Herbert von seinem spärlichen Verdienst zehn Dollar übrig hatte, dann kaufte er sich meistens eine Schallplatte mit klassischer Musik. Es verging noch einmal ein Jahr, bevor sich die ersten Patienten einstellten, und irgendwann wurde aus dem Unternehmen doch noch eine sehr erfolgreiche Praxis. Rochester war im Übrigen ein guter Ort für Familien. Da Rosemarie selbst keine Kinder bekommen konnte, adoptierten die Molsers einen Jungen, Bruce, und ein Mädchen, Kathy. Es kamen Enkelkinder, und die Ehe zwischen Rosemarie und Herbert währte schließlich 61 Jahre, bis Herbert im Alter von 92 starb.
Читать дальше