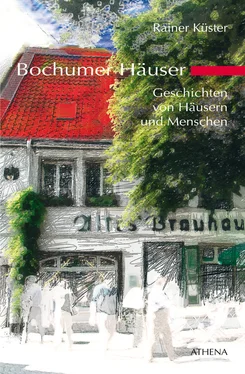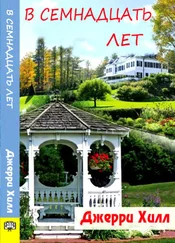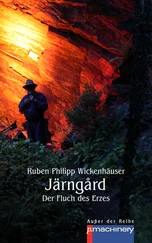Rosemarie hatte inzwischen in einer Art autodidaktischem Crashkurs Englisch gelernt. Ihre frisch erworbenen Sprachkenntnisse reichten immerhin aus für eine Anzeige in der »London Times«, in welcher sie sich als französisches Kindermädchen ausgab, das eine Stelle suchte. So kam sie zu einer netten, jungen Familie in Sussex, in der sie sich wohl fühlte und wo sie wie ein Mitglied der Familie behandelt wurde. Nur wenn der Herr des Hauses wieder mal zu viel Whisky getrunken hatte, stieg er ihr nach, und sie musste sich verstecken.
Am 1. September 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus, und die Bitten Herberts wurden immer dringlicher. Doch Rosemarie zögerte noch. Durfte sie nach Afrika emigrieren, während ihre Eltern und die jüngere Schwester unter schwierigsten Bedingungen noch in Bochum wohnten? Die ältere Schwester und ihr Mann hatten es zwar geschafft; sie lebten seit ein paar Monaten in New York. Aber die Eltern konnten kein Visum für die Vereinigten Staaten bekommen, und um nach England zu emigrieren, hätten sie mehr Geld gebraucht, als sie noch hatten. Es gab wohl mütterlicherseits ein paar englische Vettern, doch die waren desinteressiert und wollten nicht helfen, denn sie schämten sich ihrer deutschen Verwandtschaft. Was Rosemarie betraf, so hatte sie immer noch ihren deutschen Pass, das »J« kümmerte die Engländer wenig, denn sie wurde nun als »enemy alien«, als feindliche Ausländerin, angesehen.
Schließlich entschied sie sich doch für Afrika, ventilierte aber durchaus selbstbewusst, wie es nach ihrer Ankunft weitergehen könnte. Sie würde ohnehin nur dann in Afrika bleiben, wenn es ihr dort auch gut gefiel. Wenn nicht, blieb ihr immer noch die Möglichkeit, zur Schwester nach Amerika weiterzureisen. So etwa stellte sie sich die nähere Zukunft vor.
Die Flüge in den Kongo gingen ab Brüssel. Sie brauchte also ein Visum für Belgien, damals noch ein neutrales Land. Es begann ein Hindernislauf ohnegleichen. Die belgische Botschaft stellte sich stur, wollte keine jüdischen Flüchtlinge mehr im Lande haben. Rosemarie war hartnäckig und verbrachte zwei Tage auf den Stufen der Botschaft in London. Die genervten Belgier gaben ihr am Ende, was sie brauchte. Die Familie, bei der sie als Kindermädchen gearbeitet hatte, brachte sie an die Fähre in Dover. Es war ein Abschied für immer. Alle Mitglieder dieser englischen Familie kamen beim deutschen Blitzkrieg im Jahre 1940 um, ein Schicksal, das Rosemarie höchstwahrscheinlich mit ihnen geteilt hätte, wäre sie damals in England geblieben.
Die Überfahrt nach Antwerpen war gespenstisch, denn die Engländer hatten den Ärmelkanal vermint, um deutsche U-Boote zu treffen. Selbst der Kapitän kannte die Position der Minen nicht. Die Passagiere mussten sich an Deck aufhalten und ständig Schwimmwesten tragen. Die See war rau, und es blies ein kalter Wind. Aber alles ging gut. Zur Feier der glücklichen Ankunft in Antwerpen gab es Applaus, die Passagiere fielen sich in die Arme. Rosemarie wurde von einer Tante abgeholt, die sie dringend bat, sofort bei den Eltern anzurufen. Als sie ihnen am Telefon erzählte, was sie vorhatte, waren sie zunächst strikt gegen die Afrikareise und gaben schließlich nur zögernd ihren Segen.
Die nächsten Probleme gab es bei der belgischen Fluggesellschaft. Frankreich lag mit Deutschland im Krieg und erlaubte es deshalb deutschen Bürgern nicht, französisches Gebiet zu überfliegen. Obwohl Rosemarie dem französischen Konsulat glaubwürdig versichern konnte, dass sie weder Bomben noch eine Kamera mit sich trug, blieben die Franzosen hart. Sie könnte ja auch eine Spionin sein, sagten die französischen Beamten.
Immerhin gab es noch eine andere Möglichkeit, nämlich die Seelinie nach Belgisch-Kongo. Aber als Rosemarie im Büro der zuständigen Gesellschaft eine Fahrkarte für das nächste Schiff kaufen wollte, lachten die sie aus. Ob sie – bitte sehr – nicht wüsste, dass in Europa ein Krieg ausgebrochen war. Das müsse ihr doch klar sein, dass da gar nichts zu machen sei. Alle Kabinen waren restlos ausgebucht, mindestens für das nächste halbe Jahr. Rosemarie brach zusammen, begann zu weinen, und alle Leute um sie herum wurden auf sie aufmerksam, einige bedauerten sie. Ein Mann, der unmittelbar hinter ihr stand, sprach sie an:
»Jetzt lass das mal sein, und hör mir zu!«
Er war ein junger katholischer Priester, der ruhig und verständnisvoll wirkte. Es wurde still in dem Büro.
»Mein Kind,«, sagte der Priester, »du hast das ganze Leben noch vor dir. Ich will zwar in den Kongo, wo ich meinen Dienst in der Gemeinde antreten möchte. Aber du musst dein Leben retten. Wenn mich die Deutschen schnappen, kann mir nicht viel passieren. Aber wenn sie dich schnappen, wird es ganz schlimm. Hier, nimm meine Fahrkarte nach Afrika. Ich habe einen Platz für das nächste Schiff gebucht. Gott sei mit dir!«
Bevor Rosemarie auch nur reagieren konnte, hatte er ihr schon sein Ticket in die Hand geschoben und war in der Menge verschwunden.
Am 25. September 1939 ging Rosemarie an Bord der Leopoldville. Das Ziel war die Westküste Afrikas. Sie teilte sich eine Kabine mit zwei jungen Frauen aus Belgien. Gemeinsam waren sie die einzigen weiblichen Wesen an Bord. Der Rest waren Männer, dreihundert an der Zahl, die alle irgendwo im Kongo arbeiteten. Es sei eine wunderbare Reise gewesen, sagt Rosemarie Molser, man tanzte und feierte und konnte für zwei entspannte Wochen das ganze Elend hinter sich lassen.
In Matadi ging sie von Bord und nahm den Zug nach Leopoldville, dem heutigen Kinshasa. Im Hotel fand sie einen Gruß von Herbert vor. Und doch, sie war jetzt wieder allein, und es wurde ihr erst richtig klar, auf was für ein Unternehmen sie sich eingelassen hatte. Am nächsten Tag ging’s weiter, mit dem Dampfer den River Congo flussaufwärts, ein bisschen wie in Joseph Conrads »Herz der Finsternis«. Das Ziel war Stanleyville, das heute Kisangani heißt, ein Ort mit bewegter Geschichte zwischen Kolonialzeit und Unabhängigkeit. In den 50er Jahren war die Stadt die Hochburg eines gewissen Patrice Lumumba, der dort später verhaftet wurde, bevor ihn seine Gegner ermordeten.
Noch einmal dauerte die Fahrt zwei Wochen, bis Herbert Molser die Adressatin seiner vielen Briefe endlich empfangen konnte. Als der Flussdampfer in Stanleyville anlegte, stand er schon am Kai und wollte Rosemarie mit einem Kuss begrüßen. Aber die war sich ihrer Sache noch längst nicht sicher und drehte vorsichtshalber den Kopf zur Seite. Mit den beiden fing es nicht gerade enthusiastisch an. In Herberts Auto, einem Cabrio der Marke Oldsmobile, wurden sie schon nach wenigen Minuten von einer Frau angehalten, die dem Doktor in französischer Sprache signalisierte, sie werde am Nachmittag in seine Praxis kommen, da ihr Kind krank war. Aber Herbert reagierte zurückhaltend.
»Das geht leider nicht«, sagte er zu der Frau.
»Warum nicht?«
»Ich werde heute heiraten!«
»Wie bitte?«, fragte Rosemarie, die ja Französisch konnte und alles verstanden hatte.
Herbert war verwundert: »Hast du denn meine Briefe nicht bekommen?«
»Welche Briefe?«
»Ich habe dir an alle Stationen des Flussdampfers Briefe geschrieben, in denen ich die Situation genau erklärt habe!«
»Man hat mir keine Briefe gegeben!«
Nun war es an Herbert, die Sache aufzuklären. Es gab inzwischen neue Vorschriften in der belgischen Kolonie. Ausländerinnen, die in den Kongo einreisten, hatten nachzuweisen, dass sie finanziell unabhängig waren, oder sie mussten einen Ansässigen heiraten, und zwar innerhalb von 48 Stunden nach ihrer Ankunft. Nur wenn Herbert und Rosemarie sich trauen ließen, durfte sie bleiben. Da sie zu allem Überfluss an einem Freitag angekommen war, mussten sie bis um vier Uhr am Nachmittag geheiratet haben. Anschließend war das Standesamt bis zum Montag geschlossen. Das war zu spät, denn inzwischen würde man Rosemarie schon wieder zurückgeschickt haben, und zwar nach Deutschland.
Читать дальше