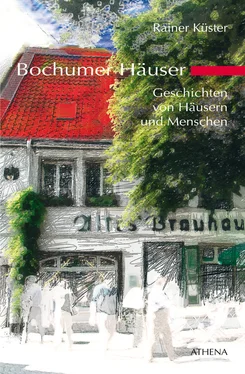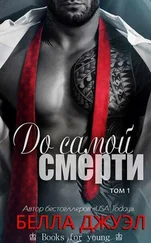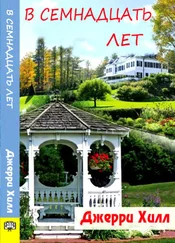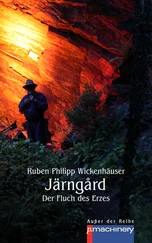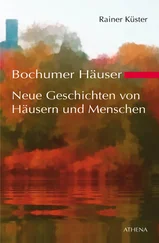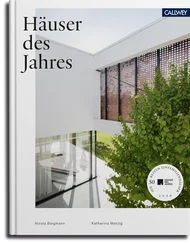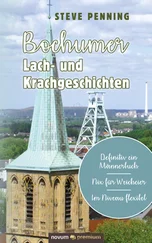Wenig später kam aus der Goethestraße auch die ältere Schwester mit ihrer Familie ins Haus an der Parkstraße. Sie alle hatten Angst um den Schwager, mussten befürchten, dass er verhaftet würde. Noch am Abend machten sich die junge Frau und ihre Schwester gemeinsam mit dem Schwager auf und schleusten ihn irgendwie zum Bahnhof, wo sie ihn zunächst einmal unter einer Bank im Wartesaal versteckten. Wie durch ein Wunder gelangten sie wieder heil nach Hause. Die Bäume im Park waren schon groß genug, um Schutz zu bieten. Als sie zu Hause ankamen, war es inzwischen 6 Uhr morgens.
Dann passierte es. Die Eingangstür der Villa wurde aufgebrochen. Die Bewohner hörten, dass Holz splitterte und Glas zerbrochen wurde. Etwa dreißig Männer, einige von ihnen trugen Reitstiefel, stürmten ins Haus. Sie waren mit Hämmern und Äxten bewaffnet. Einer konnte ein bisschen Klavier spielen. Er setzte sich sogleich an den Flügel, den die Mutter – eine ausgebildete Pianistin – so sehr liebte, und spielte das Horst-Wessel-Lied. Anschließend trampelten fünf andere mit ihren Stiefeln auf dem Resonanzboden des Flügels herum, bis er zerbrach. Die Horde zerschlug in ihrer Zerstörungswut alle Kunstschätze, die im Gebäude gesammelt und sorgfältig aufbewahrt worden waren. Auch drei oder vier Originale von Hans Thoma waren darunter gewesen, eines bedeutenden Schwarzwälder Malers, der bei den Nazis nicht unbedingt im Ruf eines »entarteten Künstlers« gestanden hatte. Nach zwei Stunden war der Spuk vorbei.
Auf den Bochumer Straßen aber war die Sache noch nicht beendet. Im Laufe des Vormittags wurden jüdische Männer, junge und ältere, die nicht mehr hatten fliehen können, von den Nazis zusammengetrieben und auf offenen Lastwagen abtransportiert. Die junge Frau aus der demolierten Villa am Stadtpark hatte sich in ihr Zimmer zurückgezogen. Als sie aus dem Fenster blickte, sah sie, dass ein Jugendfreund mit vielen anderen auf der Pritsche eines Lastwagens stand. Die Verhafteten wurden von dem NS-Pöbel beschimpft, gedemütigt und mit Peitschen geschlagen. Als der Wagen anfuhr, blickte der Freund nach oben. Die junge Frau meinte, Tränen in seinen Augen zu sehen.
In Rosemarie, so hieß sie, starben an diesem Tage alle Heimatgefühle, die mit der Villa am Stadtpark verbunden gewesen waren. Obwohl sie so jung war, lag die Geborgenheit der Kindheit weit zurück. Sie wusste, dass sie in Bochum nicht würde bleiben können. Ihr Vater, Dr. Julius Marienthal, war – wie sein späterer Kollege Josef Hermann Dufhues – ein angesehener Rechtsanwalt und Notar gewesen. Als so genannter Altanwalt, Offizier und Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg war er mit seiner Familie bisher zumindest körperlich verschont geblieben. Beruflich sah die Situation schon erheblich schwieriger aus; im Jahre 1935 hatte er zugleich mit anderen jüdischen Rechtsanwälten sein Amt als Notar in Bochum verloren, und seit kurzem durfte er nur noch als jüdischer »Konsulent«, also als Rechtsbeistand für Juden tätig sein.
Die Mitglieder der Familie mussten ständig auf der Hut sein. Rosemarie hatte den Eltern schon früher Sorgen bereitet. Wegen einer unbedachten Äußerung war sie drei Jahre zuvor vom weiteren Besuch ihres Lyzeums, welches seit 1937 den Namen Schiller-Schule trug, ausgeschlossen worden. Jemand hatte sie wohl denunziert, vielleicht unfreiwillig. Drei Jahre lang hatte sie dann in der Schweiz eine von Nonnen geleitete Schule besucht, bis die Eltern ihren Internatsaufenthalt nicht mehr bezahlen konnten. Nur mit Mühe hatte sie – ziemlich genau eine Woche, bevor der NS-Pöbel in ihr Elternhaus eingedrungen war – wieder nach Deutschland einreisen können, denn in ihrem Ausweis war ein großes »J« eingestempelt, das sie als Jüdin und damit als unerwünscht kennzeichnen sollte. Auf der Heimreise hatte sie sich als Nonne verkleidet. Anfang November des Jahres 1938 war sie in ihr Elternhaus in Bochum zurückgekehrt.
Eine Woche später, also nach dem 9. November, der Pogromnacht, war der Familie Marienthal endgültig klar – es ging jetzt für die Tochter nur noch ums Überleben. Und rückblickend kann man erleichtert sagen: Irgendwie hat es am Ende geklappt, so lange es auch gedauert hat. Rosemarie Molser, so heißt sie heute, lebt vierundachtzigjährig in Rochester in den Vereinigten Staaten. Wie sie allerdings dort hingekommen ist, das ist noch einmal eine Geschichte für sich. Ganz genau kennt diese Geschichte Dr. Hubert Schneider, Historiker und Vorsitzender des wichtigen Bochumer Bürgervereins »Erinnern für die Zukunft«, der sich des Gedenkens an zerstörtes jüdisches Leben in unserer Stadt angenommen hat. Ich möchte mir die Geschichte der Rosemarie Molser von Herrn Schneider erzählen lassen.
Er empfängt mich an einem spätsommerlichen Oktobertag in seiner Querenburger Wohnung, reicht mir eine Tasse Kaffee und zeigt mir ein üppiges Konvolut. Es ist gewissermaßen die schriftliche Hinterlassenschaft der Familie Marienthal, die ihm Frau Molser bei einem Amerikabesuch zu treuen Händen übergeben hat. Ich darf hineinsehen und mich kundig machen über die atemberaubende Geschichte der jungen Frau, die in ihrem Bochumer Elternhaus nicht bleiben durfte und sich auf die Reise machte. Sie selbst hat ihre Odyssee später unter dem Titel »Escape to the Congo« in dem Band »Perilous Journeys« in englischer Sprache erzählt.
Einen Monat nach den Ereignissen des Reichspogroms, der berüchtigten Kristallnacht, von denen oben die Rede war, wurde Rosemarie zur Gestapo beordert, wo man ihr klarmachte, dass sie das Land innerhalb von sechs Wochen zu verlassen habe, weil sie aus der Schweiz illegal eingereist sei. Was war zu tun? Es gab Agenturen, die Hausmädchen nach England vermittelten. Aber Rosemarie war eine höhere Tochter, wie man damals sagte, und kein Hausmädchen.
Die Familie Marienthal wurde aktiv; sie fälschte für Rosemarie eine ganze Vita als Haushilfe zusammen. Die Papiere bekundeten, dass sie kochen, bügeln, putzen, Betten machen und Toiletten reinigen konnte – was auch immer gewünscht war. Fiktive Empfehlungsschreiben von irgendwelchen Hausfrauen wurden beigefügt. Mit diesen Papieren konnte sie sich bewerben. Die Wirkung blieb nicht aus, es gab tatsächlich ein Angebot aus England. Im Februar 1939 gelangte sie nach High Wycombe im schönen Buckinghamshire, nordwestlich von London. Aber die Hausfrau, für die sie dort tätig sein musste, war ein regelrechter Drachen, überhaupt nicht interessiert an dem jüdischen Schicksal des Mädchens. Sie fand denn auch schnell heraus, dass Rosemarie nichts von alledem konnte, was in ihren wunderbaren Papieren stand. Hinzu kam, dass sie an der Schule zwar die alten Sprachen und Französisch gelernt hatte, nicht aber Englisch. Ein schwieriger Anfang.
Der einzige Trost waren die vielen Briefe, die sie auch in England regelmäßig aus Afrika erreichten. Sie stammten von dem jüdischen Arzt Herbert Molser, der früher einmal in Deutschland Rosemaries Onkel behandelt hatte und mit dem sie seit ihrer Zeit im Schweizer Internat in Briefkontakt stand. Molser war zwölf Jahre älter als Rosemarie und praktizierte nun in Belgisch-Kongo, dem afrikanischen Land, das später, nach der Unabhängigkeit, Zaire hieß und sich heute Demokratische Republik Kongo nennt. Rosemarie hatte die Briefe, die Herbert aus seiner afrikanischen Einsamkeit schrieb, anfangs nicht so recht ernst genommen. Da war der große Altersunterschied, und auch die Eltern waren skeptisch gewesen. Aber allmählich fand sie doch Gefallen an der Korrespondenz.
In seinen Briefen versuchte Herbert ihr klarzumachen, dass es nach dem Einmarsch der Deutschen in der Tschechoslowakei und dem Anschluss Österreichs nur noch eine Frage der Zeit sein würde, bis Rosemarie auch in England nicht mehr sicher war. Sie solle nach Afrika kommen; dort würde ihr nichts passieren, und außerdem konnte sie ihm in seiner Praxis helfen.
Читать дальше