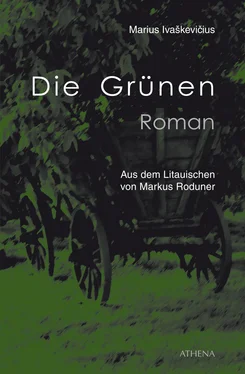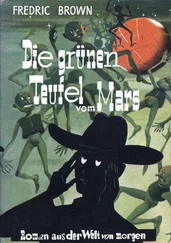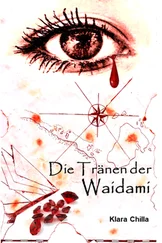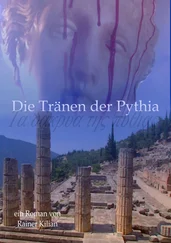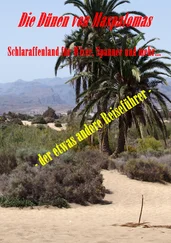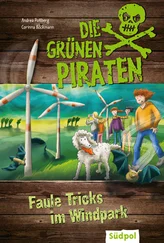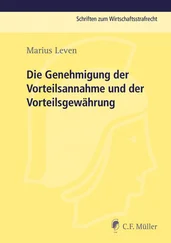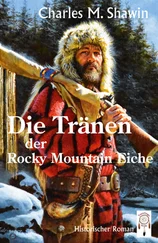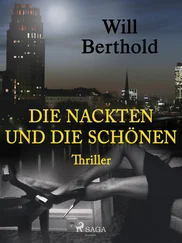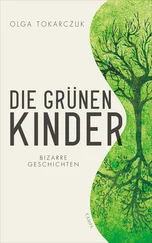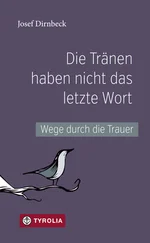»Und er sie – wie einen gefällten Baum. Wie zum Fleischer.«
»Und lebt, als wäre nichts geschehen.«
»Als ob nichts, rein gar nichts geschehen wäre.«
Wir brauchten seinen Tod wie die frische Luft. Als ob wir viele Jahre lang im Gestank verbracht hätten. Und jemand im Vorbeigehen uns zuriefe: »Macht das Fenster auf«. – »Es ist doch zugenagelt«, erwiderten wir, »von draußen. Hermetisch.« – »Was sagt ihr da«, ertönte die Antwort von dort, »Dummköpfe. Was für Dummköpfe«.
Und dieser Schluck frische Luft war unser heutiges Tagesziel. Für den einundzwanzigsten August. Wir fuhren zu dem, der gelernt hatte zu leben, als wäre nichts geschehen.
»Wenn ich Ihnen einen Kamm zwischen die Füße klemmen würde«, sagt jetzt Molkerei zu mir, als wir über ein Feld fahren, »könnten Sie dann damit ihr Haar berühren?«
»Ein seltenes Exemplar von Schweinehund«, sagte sie damals noch, als sie zurückkehrte, um mir die Nachricht zu bestätigen. »Dieser Jonas Žemaitis. Aber die Leute verwechseln Sie beide nicht mehr.«
»Ich könnte«, sagt sie jetzt und lächelt. »Doch bei mir würde da innen alles zerplatzen. Würde durch den ganzen Körper hin aufbersten …«
»Sie selbst könnten es wahrscheinlich nicht«, zweifelte sie damals. »Sein Vor- und Nachname …«
»Meinst du denn, niemand irrt mit Schuhen deiner Größe durch die Welt?«, erwiderte ich. »Ich werde ihn ohne zu zögern umlegen.«
»Schuhe sind etwas anderes«, sagte sie.
Sie meinte damit, dass es nicht einfach sei, einen Menschen umzulegen, in dessen Kopf dein Name einen ganz anderen Sinn bekommt. Seinen Sinn.
»Sie könnten doch nicht einmal ein Bein auf das andere heben«, sagt sie jetzt. »Sie sind doch ganz und gar unbeweglich.«
»Stimmt nicht«, erwidere ich, »Ich sitze sogar gern so.«
»Ich habe Sie das Bein heben sehen«, sagt sie. »Nicht selten fällt Frauen das Gebären leichter, als Sie ein Bein auf das andere legen …«
»Interessantes Zusammentreffen«, sagte ich vor zwölf Jahren zu ihm. »Ich habe schon von einigen gehört, vielleicht waren auch Sie darunter, doch bisher bin ich noch keinem begegnet. Jonas Žemaitis.«
Er nuschelte irgendetwas. Erst später begriff ich, dass er »Jonas Žemaitis« gesagt hatte. Er sagte es auf seine Weise. Es war Januar 1938, ich war noch nicht verheiratet, es regnete, in meiner Seele herrschte Leere, doch ich trat nur zu ihm, weil er Jonas Žemaitis war.
»Die Rente meiner Mutter.« Er fuchtelte mit ein paar Litas-Banknoten vor meiner Nase herum. »Ihr geht’s schlecht, die Wirbelsäule.«
Ich fragte, wie sie heißt.
»Anelė. Und Ihre?«
»Nein«, erwiderte ich. Nicht Anelė.«, und fügte an, »Waren Sie im Krieg?«
Ich sah nämlich die schlimme Narbe unter seinem rechten Ohr.
»Haben Sie auch so eine?«, fragte er mich.
»Habe ich«, gab ich zur Antwort, »nur am Bein. Und keine Narbe, sondern einen Leberfleck. Grau, mit Haaren überwachsen. Mein einziges besonderes Merkmal.«
Ehrlich gesagt, zwei Autos desselben Modells hätten sich mehr zu sagen, als wir zwei.
Ich berührte seine Narbe. Er machte einen Satz rückwärts, schüttelte sich auf seltsame Weise.
»So ein Zufall«, sagte er, »die Mutter heißt nicht Anelė. Bleiben wir so stehen?«
Er ging, ohne sich noch einmal umzuwenden.
»Seltsam«, sagte Molkerei. »Er hat sich so lange versteckt und jetzt ist er plötzlich wieder da.«
»Er ist müde«, antwortete ich ihr.
»Glaube ich nicht«, sagte sie ungläubig.
Ich meinte damit, dass man davon viel müder wird als von körperlicher Arbeit, und dass sie keine Nachricht über ihn überbracht hat sondern eine von ihm, und dass nicht wir ihn umbringen wollen, sondern dass er will, dass wir ihn umbringen. Und dass mein Vor- und mein Nachname, die, wenn sie gerufen werden, einen anderen Sinn erlangen – seinen Sinn –, ihn mehr ermüden als wir. Ich meinte damit, dass jemanden verraten nicht einfach ist. Noch viel meinte ich damit, doch wir legten uns schlafen.
Wir verurteilten ihn auf unseren Pritschen, den Kopf auf die Hand gestützt und wünschten einander:
»Gute Nacht.«
»Gute Nacht.«
Wir wünschten es einander, als wäre nichts geschehen.
Zu ihm sind wir jetzt unterwegs.
2
Aus Wassili Sinizyns Verhörprotokoll
Mir wird manchmal vorgeworfen, ich spreche nicht in der richtigen Person. Ich sage zum Beispiel: »Wassili Sinizyn ist aus Sibirien. Aus der Oblast Omsk.« Dann fragen mich die, warum in der dritten Person? Doch das ist nicht »in der dritten Person«. Das ist die erste Person, die weiß, »Wassili Sinizyn, aus Sibirien, aus der Oblast Omsk« wird nach dem den Worten Name, Vorname, Nationalität, Wohnort folgenden Doppelpunkt eingetragen werden. Eine Variante der ersten Person sozusagen, bestimmt für die Buchhaltung. Das ist absolut keine dritte Person.
Dann sagen die noch, ich sei ein Schwätzer.
Soviel zu meiner Herkunft. Die Sinizyns leben dort schon seit hundert Jahren. Manchmal sagt man »hundert Jahre« und meint damit, seit Ewigkeiten, nicht aber seit hundert Jahren. »Wir haben uns seit hundert Jahren nicht gesehen« oder »ich war seit hundert Jahren nicht mehr zu Hause«. Auch ich selbst habe meinen Vater in Omsk schon seit hundert Jahren nicht mehr in der Oblast Omsk, im Dorf Woroschilowo besucht, doch das heißt, dass ich dort seit neun Jahren und ein paar Monaten nicht mehr gewesen bin. Doch die Sinizyns haben sich vor genau hundert Jahren in Woroschilowo niedergelassen. Das heißt, dass im September 1851 Anatoli Iwanowitsch Sinizyn auf Geheiß des Zaren ins Dorf Starostojiza verbannt wurde. Das liegt sieben Kilometer von Woroschilowo. In den hundert Jahren haben wir uns weiter ausgedehnt.
Russe. Auch burjatisches Blut. Ganz wenig nur, würde man es in ein Glas Wasser schütten, so verfärbte sich das Wasser nicht rot.
Ich habe achtundzwanzig Jahre auf dem Buckel, Eltern, ab und zu schreibe ich ihnen, einen guten Bekannten in Moskau und einen einzigen Freund. Manchmal sagt man »einen einzigen Freund«, wenn man hunderte hat, doch man will einen davon besonders hervorheben. Ich habe genau einen Freund, er sitzt auf der anderen Seite der Wand, in genauso einer Einzelzelle wie ich, und der Mensch, der jetzt meine Worte aufschreibt, kommt gerade von dort. Mein Freund heißt Afanassi.
Man will uns freilassen, sobald wir ausgepackt haben.
Nach dem Krieg arbeitete ich als Aufseher in einem Kriegsgefangenenlager und schickte jede Woche einen Brief an meinen Moskauer Freund. Meinen Moskauer Freund, meinen guten Bekannten Lebedew also, hatte ich bis dahin nur einmal gesehen. Ich sage einmal, weil er mein Krankenzimmer verlassen hatte und nie zurückgekehrt war. Das war im Großen Krieg gewesen.
In meinen Briefen erinnerte ich ihn nur an mich, dass es in Russland einen Sinizyn gab, der in einem Kriegsgefangenenlager arbeitete, und der, falls sich die Gelegenheit ergäbe, das Lager um einige Insassen reicher machen wollte – unter persönlicher Teilnahme.
Oberst Lebedews Brief wurde mir persönlich überreicht, vom Schichtvorsteher. Die Gelegenheit ergab sich. Und so kamen Afanassi und ich nach Moskau. Er wartete unten, ich ging nach oben und sprach eine halbe Stunde lang in seinem Wartezimmer mit Lebedew. An der Wand hing ein Bild und Lebedew bat mich, es mir genau zu merken. Ich glaube, das Bild hing nur so lange an der Wand, wie ich dort war. Dann nahm man es herunter. Das Bild zeigte zwei Ritter, die aufeinander zuritten. Als ich kurz nach Verlassen des Raums nochmal zurückkam, da ich meine Mütze vergessen hatte, war das Bild nicht mehr da.
Eine Woche später kamen wir hier an.
In Lebedews Augen war ich ein junger Ehrgeizling, dem dieses Bild hätte Eindruck machen sollen.
Читать дальше