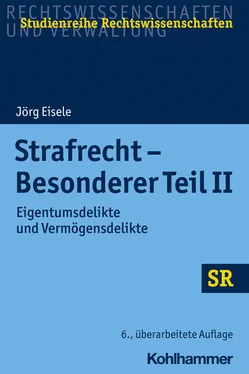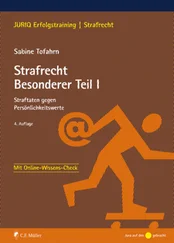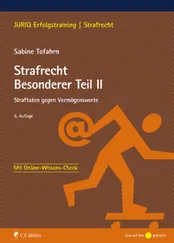258 bb)Im Gegensatz zur Rechtslage vor dem 6. StrRG 1998 ist im Übrigen nicht erforderlich, dass der Täter die Sache „in Besitz oder Gewahrsam“ hat. Daher kann § 246 unproblematisch auch bei gefundenen Sachen, bei der Plünderung eines Toten oder nur mittelbarem Besitz im Sinne des Zivilrechts Anwendung finden. Zur Begrenzung des ansonsten zu weiten Tatbestandes ist allerdings als ungeschriebene, den Tatbestand begrenzende Voraussetzung der Aneignungskomponente eine sachenrechtsähnliche Herrschaftsbeziehungzu verlangen, die spätestens zum Zeitpunkt der Manifestation der Zueignung begründet werden muss, aber auch schon zuvor bestehen kann 685. Als hinreichend wird man Gewahrsam, unmittelbaren, aber auch mittelbaren Besitz im zivilrechtlichen Sinne ansehen müssen 686. Hat der Täter bereits Fremdbesitz an der Sache, so muss sich durch die weitere Verwendung der Sache manifestieren, dass dieser in Eigenbesitz umgewandelt wird 687. Der bloße Verkauf oder das Verschenken der Sache, zu der keine Herrschaftsbeziehung besteht, d. h. die rein schuldrechtliche Einwirkung ist hingegen nicht ausreichend.
Bsp.:O hat seinen schicken Sportwagen in der gut gesicherten Garage an der Hamburger Elbchaussee stehen. Sein Neffe T schenkt den Wagen in Konstanz einem Verein zur Unterstützung brasilianischer Straßenkinder. – Der Wagen war für T eine fremde bewegliche Sache, die er sich im Wege der Schenkung grundsätzlich selbst zueignen kann 688. Weil T jedoch keinen Zugriff auf die Sache hat und das Eigentum des O daher nicht gefährdet ist, muss mangels eines sachenrechtsähnlichen Herrschaftsverhältnisses § 246 verneint werden.
259Entsprechendes gilt auch in Fällen der Drittzueignung, in denen der Dritte sich in einer sachenrechtsähnlichen Herrschaftsbeziehung zur Sache befinden oder diese jedenfalls mit der Drittzueignung erlangen muss. Die Handlung muss daher zu einer Stellung des Dritten in Bezug auf die Sache führen, wie sie auch bei der Selbstzueignung für die Tatbestandsverwirklichung erforderlich ist 689.
Bsp.:T sagt der D am Telefon, dass sie das unverschlossene Fahrrad des O an der Flussbrücke im Nachbarort abholen könne. – Eine Drittzueignung scheidet mangels Herrschaftsbeziehung aus. Nimmt D das Fahrrad in Kenntnis der Umstände, so verwirklicht sie § 242; T ist hierzu Anstifter.
260 cc)Eine Drittzueignung ist durch bloßes Verschaffen der Herrschaftsbeziehungmöglich. Der Täter braucht entsprechend den bei § 242 dargestellten Grundsätzen 690keinen eigenen Vorteil erlangen. Es genügt demnach, dass die Sache unter dauerndem Ausschluss des Eigentümers in das Vermögen des Dritten eingeordnet werden soll 691. Eine Billigung, Mitwirkung oder Aneignung des Drittenist nicht notwendig, so dass auch die aufgedrängte Sachherrschaft die Drittzueignung begründet 692.
Bsp.:T stellt dem D einige von O geliehene Bücher in das Regal, die D jedoch gar nicht haben möchte. – Man kann hier bereits eine Selbstzueignung durch Schenkung annehmen 693; ansonsten liegt jedenfalls eine Drittzueignung vor, bei der allein der Wille des Täters maßgeblich ist.
261 dd)Wirkt der Dritte an der Tat mit, so ist eine täterschaftliche Drittzueignung von einer Teilnahme an der Selbstzueignung des Drittenabzugrenzen. Es gelten hierfür die allgemeinen Grundsätze zur Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme. Aufgrund der Einbeziehung der Drittzueignung ist Täterschaft freilich in einem recht breiten Bereich möglich. Bei Mittäterschaft genügt es, wenn einer der Beteiligten in einem sachenrechtsähnlichen Herrschaftsverhältnis zum Zueignungsobjekt steht. Bloße Beihilfe kommt in Betracht, wenn der Täter für den Dritten nur die Gelegenheit für die von diesem zu vollziehende Unterschlagung schafft 694.
Bsp.:T, der eine Autowerkstatt betreibt, hat den teuren Geländewagen des O zur Reparatur. T weiß, dass D seit langem ein solches Modell sucht. Er informiert daher den D. Mit vereinten Kräften wird das Fahrzeug auf einen Transporter verladen und zu D gebracht. – Eine Selbstzueignung des T liegt nicht vor, da er nicht als Veräußerer oder Schenker, d. h. wie ein Eigentümer auftritt. T und D sind aber angesichts der jeweils erheblichen Tatbeiträge Mittäter einer Unterschlagung, wobei bei T Drittzueignung und bei D Selbstzueignung vorliegt. Dem T war der Wagen zudem anvertraut, so dass er sich gemäß §§ 246 Abs. 1 und 2, 25 Abs. 2, 28 Abs. 2 strafbar macht 695; D macht sich nach §§ 246 Abs. 1, 25 Abs. 2 strafbar.
262 ee)Umstritten ist der Tatbestand in Fällen der wiederholten Zueignung der Sache, d. h. in Konstellationen, in denen der Täter die Sache schon zuvor durch eine Eigentums- oder Vermögensstraftat (z. B. §§ 242, 246, 249, 253, 255, 263) erlangt hat.
Bsp.:T hat den Besitz an einer wertvollen Bibel aus dem 17. Jahrhundert durch Betrug nach § 263 gegenüber O erlangt. Nunmehr veräußert er diese an den gutgläubigen D, wobei ihn der Gehilfe G unterstützt. – Der Verkauf an D begründet zunächst keinen weiteren Betrug, wenngleich T über die Eigentümerposition täuscht; aufgrund des gutgläubigen Erwerbs nach §§ 929 Satz 1, 932 BGB erleidet D aber richtigerweise keinen Schaden 696. Im Weiterverkauf an D ist die Zueignung der fremden Sache des O zu sehen. Allerdings hat sich T die Sache schon im Wege des Betruges zugeeignet. Für die Strafbarkeit des G ist entscheidend, ob überhaupt eine Haupttat des T vorliegt.
263Zu beachten ist zunächst, dass in solchen Fällen die Subsidiaritätsklauselnicht einschlägig ist, weil diese – wie der Wortlaut „die Tat“ zeigt – nur Fälle zeitgleicher Zueignung regelt 697.
264 (1)Nach Rechtsprechung und Teilen der Literatur soll eine erneute Zueignung der Sache schon nicht tatbestandsmäßigsein, wenn der Täter sich bereits strafbaren Eigenbesitz an der Sache verschafft hat 698. Dafür wird der Wortsinn der Zueignung angeführt, der von einer Herstellung der Herrschaftsmacht über die Sache ausgeht, nicht dagegen von einer bloßen Ausnutzung einer einmal begründeten Herrschaftsposition. Auch würden ansonsten die Verjährungsregelungen ausgehebelt, da jede erneute Betätigung des Zueignungswillens zu einem neuen Delikt nach § 246 und daher zum Lauf einer neuen Frist führen würde. Die h. L. bejaht den Tatbestand, nimmt aber hinsichtlich der erneuten Zueignung auf Konkurrenzebene eine mitbestrafte Nachtatan 699. Sie möchte vor allem Strafbarkeitslücken bei Teilnehmern, die – wie im vorgenannten Beispiel – an der Zweitzueignung beteiligt sind, verhindern. Allerdings muss man sehen, dass diese Lücken durch §§ 257, 259 in weiten Teilen geschlossen werden können. Daneben wird als Begründung angeführt, dass auch eine bereits entzogene Sache gegen weitere Verletzungshandlungen geschützt werden müsse. Dafür spricht, dass es im Beispielsfall keinen Unterschied macht, ob der Täter sich die Sache erneut durch Verkauf an den Dritten selbst zueignet oder ein Dritter die Sache nunmehr unterschlägt. Auch ist zu beachten, dass § 246 als weiter Auffangtatbestand konstruiert ist und selbst dann einschlägig ist, wenn die andere Straftat mit der Zueignung zeitlich zusammenfällt; in diesem Fall tritt § 246 „nur“ im Wege der Subsidiaritätsklausel zurück 700. Im vorgenannten Beispiel ist nach der Gegenposition schon der Tatbestand des § 246 Abs. 1 zu verneinen; eine Beihilfe des G scheidet demnach aus; allerdings kommt eine Strafbarkeit nach § 257 wegen Begünstigung in Betracht. Nach der vorzugswürdigen Lösung ist der Tatbestand des § 246 Abs. 1 verwirklicht, tritt allerdings hinter § 263 zurück; G macht sich nach §§ 246 Abs. 1, 27 strafbar 701.
Читать дальше