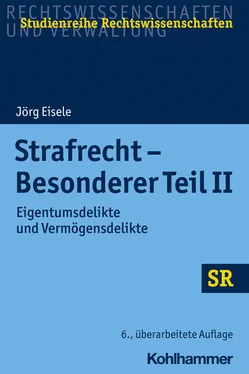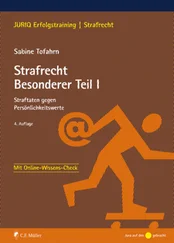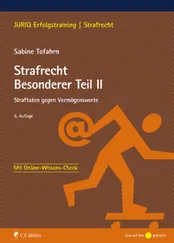252 b)Die Auslegung der Selbst- bzw. Drittzueignungerfolgt in Anlehnung an die für § 242 entwickelten Grundsätze. Die dort diskutierten Probleme im Bereich Enteignung und Aneignung (z. B. Substanzzueignung oder Sachwertzueignung) können daher auch im Rahmen des § 246 zu erörtern sein. Die Preisgabe, Beschädigung oder Zerstörung einer Sache wird daher nicht erfasst 665.
Bsp.:T findet auf der Straße eine Puppe des Nachbarkindes O. Weil T dieses nicht leiden kann, zerstört er die Puppe bzw. ermöglicht dem D die Zerstörung. – Eine Selbst- bzw. Drittzueignung scheidet aus, weil es an einer Aneignung fehlt. Die Tat bewirkt lediglich eine Sachzerstörung, die von § 303 erfasst wird.
253Dabei ist die Zueignung objektives Tatbestandsmerkmal, das freilich eine gewisse subjektive Komponente aufweist, weil nach h. M. die Manifestation des Zueignungswillens entscheidend ist.
Beachte:Dass sich auch bei objektiven Merkmalen subjektive Elemente finden, ist – wie die Mordmerkmale des § 211 Abs. 2 Gruppe 2 zeigen 666– nicht außergewöhnlich.
254 aa)Zueignung ist eine aus dem Blickwinkel eines neutralen Beobachters äußerlich erkennbare Handlung, die auf den tatsächlich vorliegenden Willen des Täters schließen lässt, dass er den Eigentümer dauerhaft aus seiner Position verdrängen und die Sachsubstanz oder den Sachwert wenigstens vorübergehend dem eigenen Vermögen oder dem Vermögen eines Dritten einverleiben möchte. Aufgrund dieser Betrachtung ist es nicht notwendig, eine – bei der Tat noch gar nicht abgeschlossene – dauerhafte Enteignung tatsächlich festzustellen 667. Erforderlich ist vielmehr eine nach außen erkennbare Manifestation des Zueignungswillens, durch die auf eine dauerhafte Enteignung und vorübergehende Aneignung der Sachsubstanz oder eines in der Sache spezifisch verkörperten Sachwerts geschlossen werden kann 668. Der bloße Zueignungswille oder die bloße Willenskundgabe sind nicht ausreichend 669.
Bsp. (1):T steckt eine gefundene Geldbörse in seine Jackentasche, um diese zu behalten. – Das Einstecken stellt noch keine Manifestation des Zueignungswillens dar, weil ebenso der Schluss gezogen werden könnte, dass die Geldbörse zurückgegeben werden soll. Eine Manifestation wäre aber zu bejahen, wenn T vom Eigentümer oder einem Passanten auf den Fund angesprochen wird und dabei das fremde Eigentum leugnet; dasselbe gilt, wenn er das Geld ausgibt.
Bsp. (2): 670Kassierer T bemerkt in der von ihm eigenverantwortlich geführten Kasse ein Defizit von 1000 €. Aus Angst vor einer Kündigung verschleiert er den Fehlbestand wie folgt: Neu eingehende Zahlungen gibt er zwar in die Kasse, diese werden aber entgegen den arbeitsrechtlichen Weisungen nicht als eingegangen verbucht. Später möchte T das Defizit mit eigenen Mitteln ausgleichen. – Fraglich ist, ob das Verhalten in Bezug auf das nicht verbuchte Geld den Schluss auf eine dauernde Enteignung zulässt. Teilweise wird auf die Parallele zum Dienstmützenfall verwiesen 671, weil das Geld in die Kasse gegeben und der Arbeitgeber nur über das Bestehen einer Ersatzpflicht getäuscht wurde; folglich sei § 246 zu verneinen, so dass aufgrund der unzutreffenden Verbuchung nur § 263, ggf. auch § 266 in Betracht kommt. Dagegen wird aber vor allem angeführt, dass T das Geld aufgrund der mangelnden Verbuchung zunächst dem Eigentümer entzieht 672, um es dann sogleich als eigenes Geld zur Kompensation des Defizits in die Kasse zu geben. Der Fall ist vergleichbar mit den Rückverkaufsfällen 673, weil mit der Einzahlung des Geldes in die Kasse ohne Verbuchung das fremde Eigentum gerade geleugnet wird. Mit der mangelnden Verbuchung manifestiert sich der Zueignungswille erkennbar nach außen. Da das Geld auch anvertraut ist, macht sich T zudem nach § 246 Abs. 2 strafbar. Für diese Sichtweise spricht letztlich, dass es bei § 246 hinsichtlich der Zueignung auf den konkreten Geldschein ankommt, so dass die geplante Kompensation mit eigenem Geld unerheblich ist. Gedanken der Wertsummentheorie können allenfalls bei der (hier allerdings zu bejahenden) Rechtswidrigkeit der Zueignung zum Tragen kommen.
255Eine Manifestation der Zueignungist typischerweise im Veräußern 674, Verschenken, Verbrauchen, Verzehren und Verarbeiten der Sache zu sehen. Ferner kann dies anzunehmen sein, wenn der Täter den Gewahrsam an der Sache gegenüber dem Eigentümer leugnet 675oder die Sache so gebraucht, dass sie erheblich an Wert verliert 676. Hingegen kann bei mehrdeutigen Verhaltensweisen – wie in der unterlassenen Rückgabe einer Sachetrotz entsprechender Pflicht (z. B. nach Ablauf des Mietvertrages) – nicht ohne weiteres eine Zueignung gesehen werden 677. Denn diese kann auf bloßer Nachlässigkeit, Säumnis oder anderen Gründen (etwa Zeitmangel) beruhen.
Bsp. (1):T findet den Ehering der O; er nimmt diesen mit nach Hause und legt ihn dort in eine Schachtel. – Die Nichtanzeige des Fundes, die Nichtrückgabe und Verwahrung der Sache begründen keine Manifestation des Zueignungswillens, weil das Verhalten auch den Schluss zulässt, dass die Sache erst etwas später zurückgegeben werden soll oder der Täter den Verlierer selbst suchen möchte.
Bsp. (2): 678T gibt das von O geliehene Auto nicht rechtzeitig zurück und fährt noch ein paar Tage mehr damit herum. Mit der Weiternutzung liegt noch keine Manifestation des Zueignungswillens vor, weil diese zunächst nur den Schluss auf eine Gebrauchsanmaßung, nicht aber auf eine dauerhafte Enteignung zulässt; zu einem anderen Ergebnis kann man aber gelangen, wenn der Wagen nach außen erkennbar noch über einen langen Zeitraum genutzt werden soll, so dass der Schluss auf eine (dauerhafte) Sachwertenteignung möglich ist.
256 (1)Nach der hier vertretenen Konzeption liegt damit der Schwerpunkt im objektiven Tatbestand auf der Manifestation der Zueignung, die vom Blickwinkel eines neutralen Beobachters zu beurteilen ist 679. Ob der Täter tatsächlich einen Enteignungs- und Aneignungswillen hat, ist allein eine Frage des Vorsatzes 680. Dagegen mag man einwenden, dass dadurch die objektive und subjektive Komponente der Zueignung in der Prüfung auseinander gerissen werden. Jedoch ist dies auch ansonsten der Fall, weil der subjektive Tatbestand eben erst der Prüfung der Merkmale des objektiven Tatbestandes nachfolgt. Zudem kann so Irrtumsfällen sachgerecht über die Irrtumsregelung des § 16 Abs. 1 Satz 1 Rechnung getragen werden. Im Übrigen bleibt auch unklar, inwieweit sich der Zueignungswille von anderen subjektiven Merkmalen so maßgeblich unterscheidet, dass eine abweichende Prüfung geboten ist. Für die Falllösung selbst darf freilich die Frage der Prüfungsreihenfolge nicht überbewertet werden.
257 (2)Bisweilen wird der Charakter als Erfolgsdelikt stärker betont und daher eine bloße Manifestation des Zueignungswillens nicht für ausreichend erachtet. So wird teilweise als Voraussetzung der Zueignung die tatsächliche Aneignung der Sacheverlangt 681. Andere wiederum verlangen die dauerhafte Enteignung des Eigentümers 682bzw. zumindest eine diesbezügliche Gefahr 683, so dass die bloße Leugnung des Besitzes oder ein Verkaufsangebot gegenüber Dritten nicht genügen würde. Gegen solche Ansichten spricht jedoch, dass auf Aneignungs- und Enteignungskomponente unterschiedliches Gewicht gelegt wird. Zudem wird der Anwendungsbereich der Vorschrift erheblich eingeschränkt, weil eine dauerhafte Enteignung nur schwer festgestellt werden kann und bei der Drittzueignung ggf. eine tatsächliche Aneignung des Dritten festgestellt werden müsste, was jedoch gar nicht erforderlich ist 684.
Читать дальше