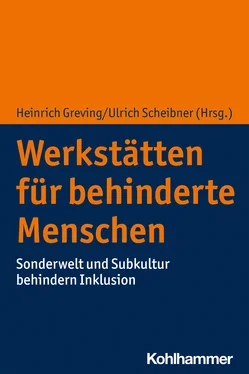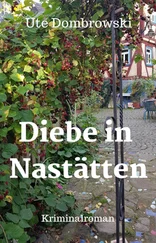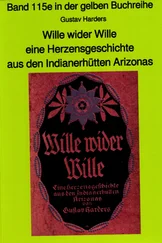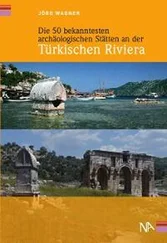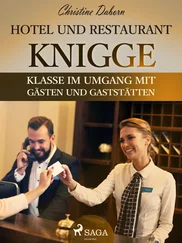ganz anderer. Denn danach folgte noch ein sogenanntes betriebsnahes Training. Diese vielen Etappen waren für mich und für den Staat nicht umsonst. Ich habe eine Menge gelernt. Der Staat hat eine Menge Geld für mich ausgegeben. Doch anders als Odysseus habe ich meinen Heimatstrand noch immer nicht gefunden. Die vorläufig letzte Insel, auf der ich am 1. Juni 2011 gestrandet war, heißt »Werkstatt für behinderte Menschen«. Hier hoffte ich auf wirksame Hilfe zur Weiterreise in die Erwerbswirtschaft. Bisher war meine Hoffnung vergebens.
Ich gehöre nicht in eine »Werkstatt«. Und doch bin ich ein typischer »Werkstatt«-Beschäftigter. Denn zwei Merkmale sind auffallend für unsere »Werkstätten«: die große Vielfalt unter ihren Beschäftigten und eine beträchtliche Anzahl, die eigentlich auf den Arbeitsmarkt wechseln könnte. »Werkstatt«-Beschäftigte haben ganz unterschiedliche Beeinträchtigungen mit ganz verschiedenen Auswirkungen. Die Unterschiede sind gut zu erkennen, selbst für Besuchsgruppen: Die einen klotzen bei der Arbeit richtig rein. Im Metallbereich und der Palettenproduktion geht es um Leistung. Andere sitzen versunken an ihren Arbeitstischen. Dazwischen gibt es alle nur denkbaren Formen der Mitarbeit. Bei wirklich echter personenbezogener Förderung könnten viele von uns ins richtige Arbeitsleben wechseln. Aber meine Erfahrung ist: Im Erwerbsleben sind wir nicht gewollt. Dort haben wir und unsere »Werkstätten« noch keinen so guten Ruf. Die Wirtschaftsunternehmen trauen uns einfach zu wenig zu. Sie kaufen sich beim Staat lieber mit einer preiswerten Ausgleichsabgabe von der Pflicht frei, auch uns eine Chance im Erwerbsleben zu geben. Wo also gehören wir eigentlich hin?
Es scheint widersprüchlich, wenn ich sage: Ich war nicht ungern in dieser »Werkstatt« in Halle an der Saale. Hier fühlte ich mich sicher und nicht überfordert. Aber am richtigen Platz fühlte ich mich nicht. Durch die ehemalige Mitarbeit in »meiner Inklusionspartei« weiß ich, dass ich solche Bedingungen auch in einem Wirtschaftsbetrieb finden könnte. Denn die sind eigentlich verpflichtet, uns einzustellen (§ 155 SGB IX) und ihre »Arbeitnehmer zu schützen und zu fördern« (§ 75 Abs. 2 BetrVG). Sie haben ausdrücklich unsere Eingliederung und

Abb. 6: André Thiel, Halle a. d. Saale
die »besonders schutzbedürftiger Personen zu fördern« (§§ 80 Abs. 1, 88, 92 BetrVG). In einem Artikel der Wochenzeitschrift DIE ZEIT las ich etwas Richtiges und Herausforderndes über Inklusion. Das hatte ein Theologe geschrieben. Es ist jetzt Teil meiner Weltanschauung geworden:
»Echte Chancengleichheit, und zwar auch für nicht behinderte Verlierer im Bildungssystem und im Arbeitsmarkt, erfordere […] eine Überwindung von Konkurrenz und Leistungsdenken – und damit womöglich des Kapitalismus. Denn Konkurrenz laufe nun einmal auf Ausgrenzung und nicht auf Solidarität hinaus. […] Statt Benachteiligte wie Behinderte oder auch Bildungsverlierer erfolglos in die dominierende gesellschaftliche Funktionslogik hineinzuzwängen, sollte man besser diese Logik aufgeben. Das schließe auch die Wachstumsgesellschaft und die allgegenwärtige Fixierung auf den Faktor Erwerbsarbeit ein« (Ekardt 2015).
Ich mochte nicht daran denken, bis zu meiner Altersrente noch mehr als ein Vierteljahrhundert in einer »Werkstatt« zu arbeiten. Mir war klar, dass ich bald den Absprung finden musste. Sonst habe ich gar keine Chancen mehr auf dem Arbeitsmarkt. Man sagt mir, das sei Träumerei. Darum habe ich viele Fragen an die Abgeordneten in den Parlamenten und an die Regierungen:
• Warum wollen uns die Arbeitgeber nicht, obwohl ihnen der Staat das Geld für angepasste Arbeitsplätze, für Nachteils- und Minderleistungsausgleich gibt?
• Warum wollen uns die Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen nicht, obwohl wir nach besten Kräften arbeiten?
• Warum verpflichtet der Staat die Unternehmen nicht, die bestehenden Gesetze einzuhalten und uns zu sich ins Erwerbsleben aufzunehmen?
• Warum machen sich die Gewerkschaften nicht für uns stark?
• Und ganz ehrlich: Was ist das für eine »Inklusionspartei«, die unsere Teilhabe am üblichen Erwerbsleben nicht auf ihrer Tagesordnung hat?
• Wäre denn die »Werkstatt« für meine weitere berufliche Entwicklung zuständig, und könnte sie das leisten? Anders gefragt: Was muss anders werden in unserer Gesellschaft und bei unseren »Werkstätten«?
Ich habe viele Fragen an die politisch Verantwortlichen. Aber das sind meine zwei wichtigsten:
• Wo gehören wir Menschen mit Beeinträchtigungen hin?
• Was muss anders werden bei unseren »Werkstätten«?
Eine der schönsten Antworten auf meine Frage, wohin wir behinderte Menschen gehören, hatte die Bundesregierung gegeben. Sie beschrieb 2018, wie sie das Gesetz zum UNO-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verwirklichen will. In ihrem »Zwischenbericht zum Nationalen Aktionsplan« heißt es: »Das Ziel […] ist die Inklusion und Teilhabe der Menschen mit Behinderungen. Danach sollen sie ein selbstbestimmtes Leben in der Mitte einer inklusiven Gesellschaft leben können ohne jedwede Diskriminierung« (BT-Drs. 19/5260, 2018, 3). Bei so schönen Worten werde ich sehr sensibel. Denn das Schlimme daran ist, dass sie so betörend klingen wie die berüchtigten Sirenengesänge in der Odyssee: »selbstbestimmtes Leben«, »in der Mitte einer inklusiven Gesellschaft«, »ohne jedwede Diskriminierung«. Mich hatten solche Gesänge in eine Hallenser »Werkstatt« gelenkt.
Ich bin ein politisch aktiver und organisierter Mensch. Darum hatte ich mich an die Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner gewandt. Immerhin ist sie in meiner früheren Partei die »Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung«. In meinem Brief vom 11.10.2019 an diese Abgeordnete schreibe ich u. a.: »Gleichwertige Lebensbedingungen für uns Menschen mit Beeinträchtigungen sind noch in weiter Ferne. Über Chancengleichheit, Dazugehörigkeit, Einbeziehung und Teilhabe wird viel geredet. Jetzt müssen weitere Taten folgen.« Am 14.11.2019 antwortete die Beauftragte per E-Mail. Sie beschrieb, was die Partei schon alles für uns getan hätte. Und dann schrieb sie: »Lassen Sie mich abschließend sagen, dass es für mich und für meine Partei, die SPD, sehr wichtig ist, dass jeder Mensch mit Behinderung Teilhabe erfahren kann.« Offen gesagt, wäre eine solche Teilhabe-Erfahrung für mich noch wichtiger als für diese Partei. Angelika Glöckner schrieb noch: »Dafür haben wir bereits viel getan und werden auch in Zukunft diesen Weg fortsetzen.«
Mit dieser Antwort vertröstet sie mich auf die Zukunft. Doch meine Zukunft liegt inzwischen hinter mir. Schon die Hälfte meines Berufslebens wurde mir durch immer neue Absperrungen, Barrieren und Umleitungen verbaut. Nach meiner Berufsausbildung im Jahr 2004 wurde mir jegliche tatsächliche berufliche Inklusion versperrt. Mein Leben ist nun mal begrenzt. Darum ist es für mich so wichtig, dass heute, dass jetzt etwas getan wird – für mich und für all die anderen mit Beeinträchtigungen, die nicht länger nur von Inklusion hören wollen. Parteipolitische Werbesprüche helfen nicht, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft inklusiv zu gestalten. Ständig auf später vertröstet zu werden, ist kein Trost. Wann also und wohin kann ich meinen Weg fortsetzen? Das Beste wird sein, ich verlasse die »Werkstatt«, sobald ich in wenigen Monaten Anspruch auf Erwerbsminderungsrente habe. Und genau das habe ich inzwischen entschieden.
Eigentlich hatte ich mir von der SPD-Beauftragten Angelika Glöckner erhofft, sie würde mir ein Stück von meinem Lebenstraum erfüllen. Dafür hätten schon einige Sätze mit guten politischen Ideen genügt. Ich hatte von ihr politische Zusagen für Maßnahmen erwartet, die uns bei der Inklusion weiter voranbringen. Eigentlich hätte mir die SPD-Parlamentarierin die folgenden fünf Antworten schreiben müssen:
Читать дальше