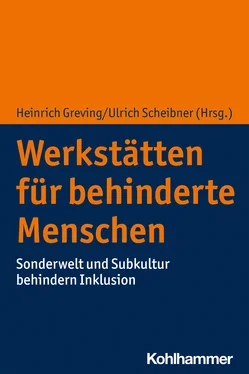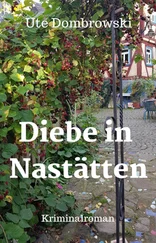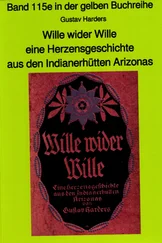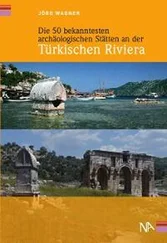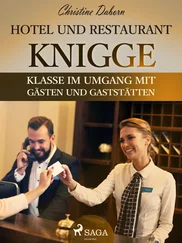Diese Hürden liegen inzwischen hinter uns. In der Courage, sie zu überwinden, ließen wir uns durch die Worte eines früheren Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der »Werkstätten« (BAG WfbM) bestärken: Günter Mosen (Jg. 1951) hatte einem aus dem BAG WfbM-Vorstand ausscheidenden Kollegen und dem damaligen Bundesgeschäftsführer mit auf den Weg gegeben, ihre kritische Haltung auch zukünftig öffentlich kundzutun:
»Dabei meine ich, Menschen am Ende oder nach dem aktiven Berufs- oder Verbandsleben sind in besonderer Weise ›theoriefähig‹. Theorie meint dabei: Sehen und sagen, wie es ist. Theoriefähigkeit ist dementsprechend die Fähigkeit, unbeeindruckt von irgendwelchen Illusionen zu sehen und zu sagen: So ist es« (Mosen 2007).
Sehen und sagen wie es ist. Das beherzigen wir mit unserem Blick auf die »Werkstätten«-Szene und beschreiben die Tatsachen in diesem Buch. In den Dankesworten des damaligen BAG WfbM-Vorsitzenden an die vor ihrer Pensionierung stehenden Leitungskräfte forderte Günter Mosen zu kritischen Aussagen auf:
»In dieser Lebensperiode des ›Zukunftsschwunds‹ gibt es keine Kompromisse, keinen Konformismus. Bis dahin erlaubt sich mancher ja nur das anzumerken und zu sagen, was die eigenen Vollendungen und das eigene Werk nicht gefährdet und die Handlungsfähigkeit nicht beeinträchtigt: was einem die Zukunft nicht allzu unangenehm macht, z .B. womit man nicht zu vielen Leuten (einschließlich unserer selbst) auf die Füße tritt. Der Blick auf die Wirklichkeit ist bis dahin darum leicht anfällig für Illusionen, denn er ist durch die Zukunft bestechlich. Diese Bestechlichkeit nimmt ab, wenn das Ende der Dienst- oder Amtszeit naht, weil immer weniger Zukunft bleibt. Darum kann man immer ungehemmter sagen, was ist: vor allem auch das, was einem nicht in den Kram passt« (ebd.).
Wir hätten uns sehr gewünscht, wenn sich die verzagten Fachleute, die uns in den vergangenen Jahren unterstützt haben, diese ermutigenden Worte des BAG WfbM-Vorsitzenden zu eigen gemacht hätten:
»Man braucht in dieser Periode nicht mehr den Wagemut der Jugend, um auch Unangenehmes zu sagen, weil nicht mehr genügend Zukunft bleibt, um wieder getreten werden zu können. Das kann man ausnutzen: Man kann ungehemmt schreiben und reden und dadurch zuweilen schamlos offen sein. Das radikalisiert den weisen Eméritus. Das ist quasi eine Traumsituation. […] Nutzen Sie die wunderbare Chance, sozusagen aus dem Hinterhalt der sogenannten passiven Phase und des Überlebens, sich zur Zukunft der Arbeit von Werkstätten und Verbänden im Spiel der Politik mit der Unbestechlichkeit Ihres Wortes zu äußern« (ebd.).
Diese Chance haben wir mit unserem Buch genutzt: Unbestechlich zu sagen, was ist und wie es werden muss. Zwei frühere Spitzenpolitiker wollten daher lieber nicht in einem Vorwort zum heutigen »Werkstätten«-System Stellung nehmen. Niemand setzt sich freiwillig ins Wespennest. Darum enthält dieses Buch keine relativierende Einleitung von Prominenten aus dem Politikbetrieb. Stattdessen hat uns der ehemalige Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, Hubert Hüppe (Jg. 1956), seine Erfahrungen und seine persönliche Bewertungen aufgeschrieben. Vor seinem Beitrag steht indes das Wort eines »Werkstatt«-Beschäftigten, der seit Jahren um das Selbstverständliche kämpft und dafür auch die Gerichte angerufen hatte: André Thiel (Jg. 1981) rang um sein Recht, als Arbeitnehmer anerkannt zu werden und den gesetzlichen Mindestlohn zu erhalten. Er steht an erster Stelle der Autoren. Man merkt seiner Darstellung über die Wirklichkeit in seiner Sonderwelt an, wie seine Hoffnung auf grundlegende Veränderungen der inklusionswidrigen Realität schwindet. Dennoch ist er zum Widerstand gegen die alltäglichen Behinderungen bereit. Seine Reformvorschläge sind ganz besonders an die Abgeordneten seiner Partei im Deutschen Bundestag gerichtet. Seine Unermüdlichkeit ist vorbildlich, seine zunehmende Radikalisierung nachvollziehbar.
Auf andere Weise ein Vorbild war und ist uns der erste gewählte Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der »Werkstätten«, Wilfried Windmöller (Jg. 1938). Seine kritische, geschichtsbewusste Reflexion und seine Überlegungen zur Zukunft der »Werkstätten« haben wir als eine Art Schlussstein ans Ende unseres Buches gestellt. Seine Biografie, seine Leistungen und seine Erkenntnisse über Fehler im Ringen um die gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen sind ein eigenes Buch wert. Die Worte eines seiner Nachfolger im Ehrenamt des BAG WfbM-Vorsitzenden scheinen wie auf ihn gemünzt:
»Die Unbekümmertheit, die Freiheit von Zwängen und Rücksichten, befördert noch einmal ein kreatives Interesse an Veränderungen – ganz anders als es uns das Bild eines unbeweglichen, nur auf den engen Umkreis des eigenen Erlebens konzentrierten Alters vermittelt. Die Lebensfreude jener Menschen, die ihre Lebensplanung noch einmal ganz neu in die Hand nehmen, vermag dies ebenso zu illustrieren wie das Alterswerk mancher Künstler, das einen radikalen Neuanfang in ihrer Biographie setzt« (Mosen ebd.).
Für unser Buch haben wir viel von früheren Beauftragten der Landesregierungen für die Belange behinderter Menschen gelernt, vornehmlich von Karl Finke (Jg. 1947), Niedersachsen, und Ottmar Miles-Paul (Jg. 1964), Rheinland-Pfalz: Aufrichtigkeit, Beharrlichkeit, Entschlossenheit und Geradlinigkeit. Ihnen muss der frühere Beauftragte der Bundesregierung, Hubert Hüppe, geradezu aus dem Herzen sprechen, wenn er die »Werkstätten« als Schimären charakterisiert ( 
Kap. 2 2 »Werkstätten« im Konflikt mit dem Grundgesetz Hubert Hüppe »Es ist nicht zu glauben, wie schlau und erfinderisch die Menschen sind, um der letzten Entscheidung zu entgehen.« Søren A. Kierkegaard (1813–1855)
). Wie alle Autoren dieses Buches tritt auch er im Alltag vorbehaltlos für die Inklusion behinderter Menschen ein. Jede Benachteiligung einer einzelnen Person, bei der er um Rat und Hilfe gebeten wird, fordert ihn heraus. Den Begriff »Einzelfallhilfe« hält er schon deshalb für falsch, weil es keine Einzelfälle sind, die an ihn herangetragen werden: »Die Missachtung elementarer Menschenrechte ist im ›Werkstätten‹-Bereich systembedingt.«
Zu den führenden »Werkstatt«-Experten in unserem Autorenkreis gehören Rainer Knapp (Jg. 1944), Herrenberg, ehem. Sindelfingen, und Franz Wolfmayr (Jg. 1953), Gleisdorf (Oststeiermark/Österreich). Der Baden-Württemberger Fachmann hat sein Menschenbild stets offen dargelegt und im Berufsleben konsequent vorgelebt. An seiner Kritik gegenüber Instanzen, die Menschen mit Beeinträchtigungen bevormunden, hat er nie Zweifel aufkommen lassen. Sein Standpunkt:
»Die Begleitung und Förderung behinderter Menschen ist ausschließlich darauf auszurichten, Fähigkeiten und Kompetenzen so zu unterstützen, dass eine selbständige Gestaltung der Lebensführung ermöglicht wird. Dies schließt Fremdbestimmung aus wirtschaftlichen oder Organisationsgründen ebenso aus wie unterschiedliche Wertvorstellungen, Anforderungen oder Erwartungen Dritter. In der Umsetzung bedeutet dies, dass eine stringente Ausrichtung an den Erwartungen und Bedürfnissen der behinderten Menschen Vorrang haben muss vor den Interessen und Organisationsbedürfnissen jeglicher Institution.«
Sein österreichischer Kollege Franz Wolfmayr kritisiert die scheinbar machtvollkommene und überhebliche Haltung deutscher Träger von Wohn- und »Werkstätten«.
»Da hieß es oft: Wir sind stark genug, wir brauchen keine Vergleiche mit anderen, wir sind hier diejenigen, die den Ton angeben. […] Die Organisationen vergleichen sich nicht mit dem internationalen Standard, und die politischen Systeme fangen damit langsam erst an, etwa mit Studienreisen« (Wolfmayr 2017).
Читать дальше