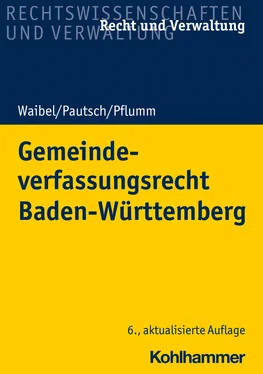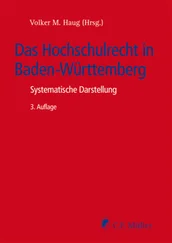13Das württembergische „Verwaltungsedikt für die Gemeinden, Oberämter und Stiftungen“ von 1822führte allgemein für alle württembergischen Gemeinden die Selbstverwaltung ein. Ähnliche Regelungen brachte das badische Gemeindegesetz von 1832für die badischen Gemeinden. Die Gemeinden hatten das Recht, „alle auf den Gemeindeverband sich beziehenden Angelegenheiten zu besorgen, ihr Gemeindevermögen selbstständig zu verwalten und die Ortspolizei zu handhaben“. Dieser Katalog umfasste nicht nur die heute üblichen Aufgaben einer Gemeinde; es gehörten auch das Polizeiwesen und die Ordnungsverwaltung, die Armenfürsorge und das Gesundheitswesen, das Gewerberecht und die freiwillige Gerichtsbarkeit dazu. Die Rechtsprechungwurde jetzt allerdings staatlichen Behörden übertragen.
14Die Bürger wählten einen Gemeinderatals Beschlussorgan auf Lebenszeit und einen Bürgerausschusszu dessen Überwachung. Vorsitzender des Gemeinderats und Vollzugsorgan war in allen Gemeinden und Städten ein auf Vorschlag der Bürgerschaft von der Regierung ernannter Ortsvorsteher (Schultheiß).Bestimmte Aufgabenbereiche der Gemeindeverwaltung waren dem Ratschreibersowie dem Gemeindepflegerübertragen. Das Bürgerrecht war weder an Gewerbebetrieb noch an Grundbesitz gebunden, sondern an ein „selbstständig auf eigene Rechnung leben“. Damit wurde ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur „Einwohnergemeinde“ zurückgelegt.
Die Gemeinden besaßen das Recht, ihr Haushaltsdefizit (den sog. Communschaden) durch eine Umlage bei den Bürgern nach dem „Ortssteuerfuß“auszugleichen.
15Der Bürgerausschusswurde im Laufe der Zeit immer stärker und direkter an Verwaltungsentscheidungen und -aufgaben beteiligt. Dieses relativ schwerfällige Zweikammersystemwurde erst im Jahr 1919 mit der Einführung der Gemeinderatsverfassung (und damit dem Einkammersystem) geändert.
Die Industrialisierung des 19. Jahrhundertsbrachte den Städten wichtige neue Aufgaben auf dem Gebiet der Verwaltung und Versorgung und veränderte damit zwangsläufig die Struktur der Kommunalverfassungen.
4.Die Selbstverwaltung im Deutschen Reich
16Die Verfassung des Deutschen Reiches von 1871enthielt noch keine Gemeindeartikel. Die Verfassungen der einzelnen Länder regelten aber bereits die Rechte zur Wahl der Gemeindevertretungen sowie zur selbstständigen Erledigung von Gemeindeangelegenheiten.
17Der Übergang zur parlamentarisch-demokratischen Verfassung nach dem Ersten Weltkrieg brachte für die Gemeindeverfassungen den endgültigen Durchbruch. In Artikel 127 der Weimarer Reichsverfassungdes Jahres 1919 wurde die Selbstverwaltung der Gemeindenals institutionelle Garantieausdrücklich verbürgt. Über Artikel 17 wurden das demokratische Wahlrecht sowie die Grundsätze der Verhältniswahl auch auf die Gemeindewahlen ausgedehnt.
18Während der Weimarer Zeitkonnte in vielen Fällen der Haushaltsausgleich nur noch über Staatskommissaredurchgesetzt werden. Der Trend der Gemeinden, die wirtschaftliche Tätigkeit zu monopolisieren und stark auszuweiten, führte außerdem zu einem heftigen Streit zwischen der privaten Wirtschaft und den Gemeinden. Das kommunale Wirtschafts- und Haushaltsrecht musste daher dringend neu gestaltet werden. Diese neuen Kriterien wurden erstmals in der Deutschen Gemeindeordnung von 1935festgelegt.
Dieses Gesetz schränkte allerdings die kommunale Selbstverwaltung wieder sehr stark ein.Die Wahlen zur Vertretungskörperschaft und zum Gemeindevorstand wurden abgeschafft, das Führerprinzip mit der Einheit von Partei und Staat galt auch auf der Gemeindeebene. Der Bürgermeister und die Beigeordneten wurden auf Vorschlag des Beauftragten der NSDAP durch die Aufsichtsbehörde ausgesucht und anschließend von der Gemeinde ernannt. Der Gemeinderat besaß lediglich beratende Funktionen. Er wurde vom Beauftragten der NSDAP im Benehmen mit dem Bürgermeister berufen.
5.Die kommunale Selbstverwaltung in der Bundesrepublik
19Nach 1945 schufen die einzelnen Länder Übergangsregelungen (DGO- Anwendungsgesetze),die sich besonders im Gemeindewirtschaftsrecht an die Deutsche Gemeindeordnung anlehnten. Während in der britischen Besatzungszone der Gemeinderat nach englischem Vorbild eine sehr starke Stellung erhielt, wurde in der französischen und amerikanischen Besatzungszone eher auf das vor 1935 geltende Kommunalverfassungsrecht zurückgegriffen.
Der Versuch der Länder, mit dem „Weinheimer Entwurf“in der Nachkriegszeit eine einheitliche Kommunalverfassung aufzustellen, scheiterte.
Die in den Jahren 1948 bis 1955 erlassenen Gemeindeordnungen der einzelnen Bundesländer wiesen bei der Rechtsstellung und den Aufgaben der Gemeinden viele Gemeinsamkeiten auf, deutliche Unterschiede bestanden aber bei den inneren Gemeindeverfassungen.
20Ausgelöst durch das Finanzreformgesetzund das Haushaltsgrundsätzegesetz(HGrG) einigten sich dann die Länder im Jahr 1973 auf ein weitgehend einheitliches Gemeindewirtschaftsrecht. Ein einheitlicher Verfassungsteil wurde damals weder angestrebt noch erreicht – die ländertypischen Besonderheiten in der Kommunalverfassung blieben sehr lange erhalten. Erst durch die Kommunalverfassungsreformen der neunziger Jahre wurde eine Annäherung erzielt: die duale süddeutsche Ratsverfassung nach baden-württembergischer Prägung wurde zur Leitverfassung in fast allen Ländern der Bundesrepublik. Lediglich Hessen hat an seiner Magistratsverfassung festgehalten, führte aber zumindest die Direktwahl des Bürgermeisters ein.
III.Die Grundlagen des Gemeinderechts
1.Europäisches Recht
21 a) Europarat: Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung.Am 1. September 1988 ist die „Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung“des Europarates in Kraft getreten. 4In dieser Charta wird völkerrechtlich verbindlich den kommunalen Gebietskörperschaftenin Europa das Recht auf Selbstverwaltungzuerkannt. 5Die nähere Ausgestaltung bleibt aber den einzelnen Staaten überlassen. Diese Charta ist kein Bestandteil des Unionsrechts und kann damit die kommunale Selbstverwaltung nicht absolut absichern.
22 b) Das Unionsrecht (Recht der Europäischen Union).Eine gewisse Absicherung der Selbstverwaltung für die deutschen Kommunenergibt sich freilich aus Art. 23 Abs. 1 GG. Danach darf die Bundesrepublik nur insoweit an der Entwicklung der Europäischen Union mitwirken, als diese sich dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet. In Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, darf deshalb die Gemeinschaft nur tätig werden, wenn die Zielsetzungen unionsrelevanter Vorgänge durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten nicht zufriedenstellend erreicht werden können. Ob die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung „europafest“ ist, hat aber auch Art. 23 GG nicht absolut geklärt. 6Die Garantie der gemeindlichen Selbstverwaltung ist im Unionsrecht jedenfalls nicht ausdrücklich verankert. Es ist auch umstritten, ob die kommunale Selbstverwaltung als „allgemeiner Rechtsgrundsatz“ dem Unionsrecht immanent ist. 7
2.Verfassungsrechtliche Bestimmungen
23 a) Gesetzgebungskompetenzen.Das Kommunalrecht gehört nicht zu den dem Bundesgesetzgeber zugewiesenen Regelungsmaterien (insb. Art. 71, 73 bzw. 72, 74 GG). Der Bund besitzt auch keine Rahmenkompetenz für diesen Bereich. Damit fällt die eigentliche Kommunalgesetzgebungin die Zuständigkeit der Länder(Art. 30 und 70 GG). Die Länder müssen sich allerdings an den durch Art. 28 GG gesteckten Rahmen halten, der eine Mindestgarantie vorgibt, die nicht unterschritten werden darf. Freilich dürfen die Länder ein „Mehr“ an kommunaler Selbstverwaltung gewährleisten, also landesverfassungsrechtlich bzw. einfachgesetzlich über den Gewährleistungsgehalt vor allem des Art. 28 Abs. 2 GG hinausgehen. 8
Читать дальше