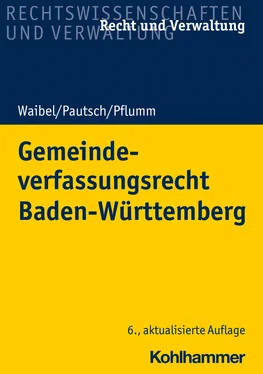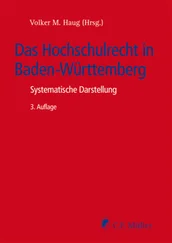Wolff, Hans J./Bachof, Otto/Stober, Rolf/Kluth, Winfried , Verwaltungsrecht I, 13. Auflage, München 2017
Erster TeilWesen und Aufgaben der Gemeinden
§ 1Einführung
I.Das Wesen der Gemeinden
1.Rechtliche Betrachtungsweise
1Im Schwabenspiegel, dem süddeutschen Landrecht aus der Zeit um 1275, wird der Begriff „Gemeinde“ als Bezeichnung für eine örtliche Gemeinschaft verwendet. Diese Gemeinschaft entwickelte sich als Genossenschaft, die bereits sehr früh Grundzüge einer kommunalen Selbstverwaltung erkennen ließ. Die Gemeinden werden daher als überkommene bzw. gewachsene Institutionen betrachtet, die die „Grundlage des demokratischen Staates“bilden. 1Das Wesen einer Gemeinde wird deshalb in den Gemeindeordnungen nur noch umschrieben durch ihre Stellung im Staat, ihre Aufgaben und ihre besondere Form der Verwaltung. Das Kommunalverfassungsrecht – oder weitgehender als Kommunalrecht verstanden – ist Gegenstand der rechtswissenschaftlichen Forschung und Lehre sowohl im juristischen Studium an den Universitäten als auch im Besonderen an den Hochschulen für öffentliche Verwaltung. 2Die rechtliche Betrachtungsweise steht auch hier im Mittelpunkt, wenngleich die Gemeindeebene fokussiert und daher von „Gemeindeverfassungsrecht“ als dem Kommunalverfassungsrecht des „Kommunetypus“ Gemeinde gesprochen wird.
2.Soziologische Betrachtungsweise
2In der Soziologie wird mit „Gemeinde“ eine Einheit auf lokaler Basisbezeichnet, in der Menschen zusammenwirken. 3Die Urform des Zusammenlebens in der Sippe, dem Klan oder dem Stamm fällt also noch nicht unter diese Gemeindedefinition, da hier eine eindeutige lokale Bindung fehlt. Diese lokale Bindung, auch als „nachbarliche Gemeinschaft“bezeichnet, steht aber bei der Wesensbeurteilung der Gemeinde im Vordergrund. Erst mit der Bindung an eine Lokalität kann sich das soziale Leben entfalten, das die Gemeinde – angefangen von den dörflichen Gemeinschaften und Markgenossenschaften der Germanen über die Munizipien der Römerzeit und den Reichsstädten des Mittelalters bis zur Jetztzeit – auszeichnet. Wichtig ist dabei die rechtliche Selbstständigkeitdieser nachbarschaftlichen Gemeinschaft. Diese Selbstständigkeit hat zur Folge, dass Rechte und Verpflichtungen der einzelnen Mitglieder nicht solche der Gemeinschaft werden. Andererseits sind aber die Mitglieder auch nicht unmittelbare Träger der Rechte und Pflichten der Gemeinde. Es findet also kein Durchgriffstatt. Die zunehmende Urbanisierung führte zwangsläufig zu einer Abnahme der nachbarlichen Kontakte und der Bindung an die Gemeinde. Deshalb wurde z. B. bei der Gebietsreformversucht, ehemals selbstständige Gemeinden als „ Ortschaften“ weiterzuführen und so die „ symbolische Ortsbezogenheit“ aufrecht zu erhalten. Andererseits begegnen dem Menschen alle gesellschaftlichen Zusammenhänge von mehr als nur familiärem Charakter zuerst in der Gemeinde. Da dies ebenso auf die Bewohner der größeren Städte zutrifft, gibt es auch hier noch lokale und gesellschaftliche Bindungen an die Gemeinde.
II.Die geschichtliche Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung
1.Der Ursprung der kommunalen Selbstverwaltung
3In seiner Urformwar das Dorf ein Zusammenschluss von sesshaft gewordenen Genossen, eine Art wirtschaftlicher Interessenverband. Die Genossen hatten sowohl persönliche als auch gebietliche Rechte und Pflichten: sie besaßen Nutzungsrechte an der Feldmark und der Allmende und mussten sich dafür an den Lasten der Gemeinschaft beteiligen. Entscheidungen wurden von der Dorfversammlunggetroffen, die Verwaltung übernahm ein gewählter Ortsvorsteher, der von Schöffen oder Ratsleutenunterstützt wurde.
4Im frühen Mittelalternahm die freie Rechtsstellung der Gemeinden ab: Das aufkommende Lehenswesen und eine beginnende Landeshoheit brachte die Bauern zunehmend in die Abhängigkeit der Grundherrschaft. Zur gleichen Zeit wuchs aber die Bedeutung der Städte. Die freien Reichsstädte und die mittelbaren Landstädte bekamen Privilegien eingeräumt bis zur unumschränkten Selbstverwaltung. Der Satz „Stadtluft macht frei“ dokumentierte die mit dem Bürgerrecht verbundene Freizügigkeit und den Anspruch auf Grundbesitz. Die Städtewaren zuständig für die Gerichtsbarkeit, den Schutz der Bürger, die Sicherung von Handel und Handwerk und die Fürsorge für Arme und Kranke. Dafür mussten die Bürger Natural- und Geldabgaben entrichten.
5 Gemeindeorganewaren der Bürgermeister bzw. Gemeindevorsteher und das Gericht mit den Stadtschöffen bzw. der Rat. Als Vorsitzender des Gerichts wurde häufig ein Schultheiß bestellt.
2.Der Rückgang unter dem Absolutismus
6Streit zwischen den Zünften und Gilden gegen die Oberschicht der Städte und die vielen Kriege des 16. und 17. Jahrhunderts ließen den Einfluss der Städte schwinden. Zugleich wuchs die Bedeutung des Staates: das Zeitalter des Absolutismusbrach an. Die Selbstverwaltung der Städte wurde durch die patrimoniale Verwaltung der Fürsten abgelöst; die Untertanen hatten „Order zu parieren“.
3.Reformen unter dem Liberalismus
7Im 18. Jahrhundert entstanden dann erstmals Landes- , Polizei- und Commune- Ordnungen(z. B. die Württembergische Communeordnung von 1758 oder das Preußische Allgemeine Landrecht von 1794). Diese Ordnungen schufen im Regelfall keine neuen Bestimmungen, sondern fassten das zurzeit geltende Recht zusammen. Sie enthielten überwiegend generelle Regelungen und Weisungen für das Verwaltungshandeln und gliederten zugleich die Städte und Landgemeinden in ein einheitliches staatliches Rechtssystem ein. Allerdings räumte die Württembergische Communeordnungden Gemeinden bereits das Recht ein, ihre Organe und Funktionsträger selbst zu wählen.
8Die Dorfgemeinden hatten als Ortsvorsteher einen selbst gewählten Schultheiß, die Amtsstädte einen staatlich bestellten Oberamtmann. Die Verwaltungsentscheidungen und die Rechtsprechung wurden von den im „Gericht“zusammengefassten Ratsmitgliedern getroffen. Für die Vermögensverwaltung war der Bürgermeisterzuständig. Die Amtsstädte wurden mit den Unterämtern (Gerichtsbezirken) und den Dorfgemeinden zu Kommunalverbänden mit der Bezeichnung „Stadt und Amt“zusammengefasst, den Vorläufern der Oberämter und der späteren Landkreise.
9Die Französische Revolution und die Niederlage deutscher Fürsten gegen Napoleon ebneten dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts dem Liberalismusden Boden. Im Zusammenhang mit dem sich jetzt entwickelnden modernen Verfassungsrecht erhielt auch das Kommunalverfassungsrecht eine neue Ausprägung.
10Reichsfreiherr vom Stein brachte 1808 mit der „Preußischen Städteordnung “den Städten die „bürgerliche Selbstregierung“. Die preußischen Städte hatten jetzt eine Doppelfunktion zu erfüllen: sie wurden Selbstverwaltungskörperschaften und dienten zugleich dem Staat als untere Verwaltungsbehörde.
11Einer Ausdehnung der Selbstverwaltungauf die Landgemeinden leisteten im norddeutschen Raum die Gutsherren erbitterten Widerstand. Am längsten dauerte dies in Preußen: hier wurde der Durchbruch erst im Jahr 1891 mit der Preußischen Landgemeindeordnungerzielt.
12Die süddeutsche Entwicklungwar stark auf verwaltungstechnische Überlegungen ausgerichtet. Die Gemeinden wurden aber sowohl in der bayerischen als auch in der württembergischen Verfassung bereits 1818 bzw. 1819 als „Grundlage des Staatsvereins“ bezeichnet.
Читать дальше