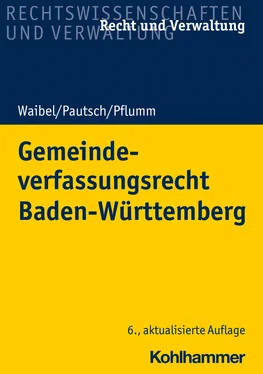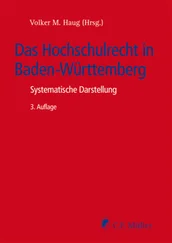3.Normenkontrolle vor dem Verfassungsgerichtshof
80Art. 76 LV eröffnet den Gemeinden und Gemeindeverbänden die Möglichkeit, beim Staatsgerichtshofein kommunales Normenkontrollverfahreneinzuleiten mit der Behauptung, ein formelles Landesgesetz würde eine Vorschrift der Art. 71 bis 75 verletzen. 65Für „untergesetzliche“ Rechtsvorschriften – d. h. solche, die wie Rechtsverordnungen im Rang unterhalb des Parlamentsgesetzes stehen, – ist im Unterschied zur kommunalen Verfassungsbeschwerde gegen Bundesgesetze diese Möglichkeit nicht gegeben. 66Wie gezeigt, bleibt dann aber die Möglichkeit bestehen, das BVerfG anzurufen, weil die Subsidiariätsanordnung in Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG dann nicht (mehr) greift. 67
81Insbesondere die gegen Maßnahmen der Rechtsaufsichtsbehörden möglichen Rechtsbehelfe sollen hier noch Erwähnung finden, da einer solchen Maßnahme im Verhältnis von Aufsichtsbehörde zur beaufsichtigten Kommune Außenwirkung zukommt. Es handelt sich um einen Verwaltungsakt i. S. v. § 35 Satz 1 LVwVfG. Dementsprechend gilt, dass die Kommunen – d. h. die betroffene Gemeinde – nach § 125 GemO Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage entsprechend den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung einlegen kann.
§ 3Rechtsstellung der Gemeinden im öffentlichen Recht
I.Stellung der Gemeinden im Staatsaufbau
82Art. 28 GG garantiert die „Einrichtung Gemeinde“ als Teil des Staatsaufbaus. In Art. 69 LV wird diese Garantie durch die Aussage ergänzt, dass die Verwaltung neben der Regierung und den ihr unterstellten Behörden auch von den Trägern der Selbstverwaltung ausgeübt wird. § 1 Abs. 1 GemO greift diese Aussage auf. Die Gemeinden werden hier als „Grundlage und Glied des demokratischen Staates“ bezeichnet.
83Dies bedeutet, dass
– der demokratische Staat auf den Gemeinden aufbaut (Grundlage) und
– die Gemeinden nicht isoliert neben dem Staat stehen, sondern als Träger eines Teils der öffentlichen Verwaltung integrierte Bestandteile des Staates sind (Glied).
84Kommunalverfassungsrechtlich gesehen gibt es keine unterschiedlichen Arten von Gemeinden. Nach § 5 Abs. 2 GemO ist es zwar möglich, Gemeinden die Bezeichnung „Stadt“zu verleihen, diese Bezeichnung hat aber keine rechtlichen Auswirkungen. Sie soll lediglich die Gemeinden herausheben, die nach Einwohnerzahl(Anhaltspunkt: mindestens 10 000 Einwohner, der Hauptanteil dieser Einwohner muss auf ein im Wesentlichen geschlossenes Siedlungsgebiet entfallen), Siedlungsformsowie den wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnissen städtisches Geprägehaben. Unterschiede zwischen den Gemeindensind in Bezug auf die Struktur, die Einwohnerzahlund die Funktionenfeststellbar.
85Diese Unterschiede werden meistens in vier Klassifikationenzusammengefasst:
– soziologischnach den Strukturunterschieden: Wohn- oder Industriegemeinde, städtische oder ländliche Gemeinde, Fremdenverkehrsgemeinde oder Kurort,
– statistischnach der Einwohnerzahl, wobeibis 20 000 Einwohnern von Kleinstädten und sonstige Gemeinden,bis 100 000 Einwohnern von Mittelstädten und ab 100 000 Einwohnern von Großstädten die Rede ist,
– funktionalnach der zentralörtlichen Bedeutung: Klein-, Unter-, Mittel- und Oberzentren, wobei die Festlegung im Regionalplan (Klein- und Unterzentren) bzw. im Landesentwicklungsplan erfolgt,
– rechtlichnach den Zuständigkeitsunterschieden: Stadtkreise, Große Kreisstädte und die übrigen kreisangehörigen Gemeinden. Stadtkreisesind Städte, die keinem Landkreis angehören, sondern selbstständig neben den Kreisen stehen. Neben dem gemeindlichen Wirkungskreis erfüllen sie auch die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde und des Landkreises als Selbstverwaltungskörperschaft. Städte können auf ihren Antrag durch Gesetz zu Stadtkreisen erhoben werden. Obwohl rechtlich keine Mindesteinwohnerzahl gefordert wird, werden faktisch doch mindestens 100 000 Einwohner verlangt. In Baden-Württemberg gibt es folgende Stadtkreise: Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe; Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, Pforzheim, Ulm und Baden-Baden. Große Kreisstädtesind kreisangehörige Gemeinden, denen ein Großteil der Zuständigkeit der unteren Verwaltungsbehörde übertragen worden ist (Negativabgrenzung über die Zuständigkeit s. § 19 LVG). Auf ihren Antrag können Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern durch die Landesregierung zur „Großen Kreisstadt“ erklärt werden. Diese Erklärung muss im Gesetzblatt bekannt gegeben werden. Rechtsaufsichtsbehördender Stadtkreise und Großen Kreisstädte sind die Regierungspräsidien. Die Bürgermeister dieser Gemeinden führen die Amtsbezeichnung „Oberbürgermeister“. Weiterhin ist das Rechnungsprüfungsamteine Pflichteinrichtung. Stadtkreise müssen darüber hinaus noch Beigeordnetebestellen. „Stadtkreis“ oder „Große Kreisstadt“ ist kein Bestandteil des Namens, sondern nur eine Zuständigkeitsbezeichnung.
III.Rechtsnatur der Gemeinden
86Die Gemeinden sind Gebietskörperschaften. Dies bedeutet:
– Sie sind Körperschaften des öffentlichen Rechtsund weisen damit folgende Merkmale auf:
– Rechtsfähigkeit,
– mitgliedschaftliche Organisation (Verband),
– Durchführung staatlicher (und als Gemeinde natürlich auch kommunaler) Aufgaben unter Anwendung hoheitlicher Mittel (z. B. Zwang),
– Beaufsichtigung durch den Staat.
– Ihre Tätigkeit wickelt sich innerhalb eines fest umrissenen Gebietsab. Daraus folgt, dass
– jeder (physische und juristische Personen oder die Eigentümer von Sachgütern), der sich auf dem betreffenden Gebiet befindet, den Herrschaftsrechten (Hoheitsrechten) der Körperschaft unterliegt und
– die Aufgabenzuständigkeit räumlich, aber nicht sachlich begrenzt ist (Aufgabenallzuständigkeit).
– Ihr Hauptorgan wird unmittelbardurch die Gebietsbewohner (Bürger) gewählt.
87Im Gegensatz zu den Gebietskörperschaften stellen Personalkörperschaftenauf persönliche Eigenschaften (z. B. Beruf) oder auf gleiche Aufgabengebiete (z. B. Unfallversicherungsverbände oder Zweckverbände) ab.
88 Körperschaften des öffentlichen Rechtskönnen nur durch einen staatlichen Hoheitsaktentstehen, verändert oder aufgelöst werden. Daher bedarf z. B. die Veränderung von Gemeindegrenzen (Gebietsänderungen) in jedem Fall der staatlichen Mitwirkung (durch Erlass eines Gesetzes oder Erteilung einer Genehmigung). Anstaltenunterscheiden sich von Körperschaften dadurch, dass sie nicht über Mitglieder, sondern allenfalls über Benutzer verfügen. Anstalten fehlt also die verbandsmäßige Struktur, welche die Körperschaften auszeichnet.
§ 4Rechtsstellung der Gemeinden im privaten Recht
I.Allgemeines
89Die Gemeinden besitzen im Privatrechtsverkehr – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dieselbe Rechtsstellung wie die übrigen juristischen Personen. Diese Rechtsstellung setzt sich aus der Rechtsfähigkeit, der Geschäftsfähigkeit, der Partei- und Beteiligtenfähigkeitund der zivilrechtlichen Delikts- und Haftungsfähigkeitzusammen.
Читать дальше