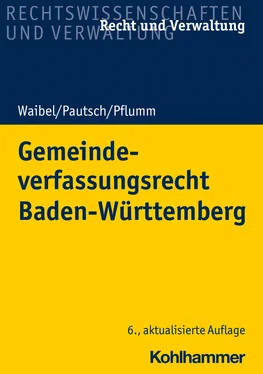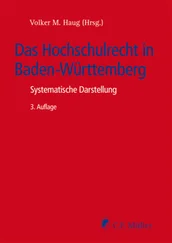68Trotzdem muss aber die gemeindliche Planungshoheit auch bei den Fachplanungen abwägungsrechtlichberücksichtigt werden, sofern von der Gemeinde eine hinreichend bestimmte Planung vorliegt und diese nachhaltig gestört wird 55oder die Fachplanung wesentliche Teile des Gemeindegebiets einer durchsetzbaren gemeindlichen Planung entzieht. 56Als „hinreichend bestimmt“ ist eine Planung dann zu werten, wenn neben dem Aufstellungsbeschluss auch bereits der Auslegungsbeschluss gefasst worden ist. Die Gemeinden besitzen insoweit klagefähige Rechte. 57Dabei ist aber zu beachten, dass ein allgemeiner (und damit unzulässiger) Eingriff in die kommunale Planungshoheit dann nicht vorliegt, wenn gesetzlich fundierte Planungen die Planungshoheit einzelner Gemeinden in klar abgegrenzten Gebieten einschränkt.Eine solche Sonderbelastung ist dann zulässig, wenn sie durch überörtliche Interessen von höherem Gewichtgetragen wird. 58
69Solche Einschränkungen der gemeindlichen Planungshoheit sind zulässig für Ziele der Raumordnung und Landesplanung. 59Dazu gehören vor allem die Raumordnungsplänenach § 8 ROG sowie die Entwicklungs- und Regionalplänenach § 9 ROG und dem Landesplanungsgesetz.
70Zur Finanzhoheit gehören eine eigenverantwortliche Einnahme- und Ausgabepolitiksowie die Vermögensverwaltungim Rahmen einer geordneten Haushaltsführung. Den Gemeinden steht es dabei frei, in welchem Ausmaß sie die ihr zur Verfügung stehenden Steuerquellen ausschöpfen. 60Die Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 78 Abs. 2 GemO sind damit nur bedingt anwendbar. Die Finanzhoheit verdichtet sich zur Finanzautonomie, wenn die Berechtigung verknüpft ist, die Finanzwirtschaft durch das Etatrecht, das Steuerfindungsrecht oder durch Abgabensatzungen ausgestalten zu dürfen.
71Die Finanzhoheit enthält einen Anspruch auf eine finanzielle Mindestausstattung (Art. 73 Abs. 1 LV), schützt aber nicht gegen die Auferlegung neuer finanzieller Lasten. Maßgeblich für Qualität und Umfang der kommunalen Finanzausstattung ist dabei das Konnexitätsprinzip, wonach die Finanzausstattung durch den Aufgabenbestand bestimmt wird (Art. 104a Abs. 1 GG). Gesetzliche Bestimmungen dürfen in die Finanzhoheit eingreifen, um zeitlich begrenzte konjunkturpolitische Maßnahmen zu regeln oder die Steuererhebung zu bestimmen. Zum Kernbereich der Finanzhoheit gehören dagegen das Etatrecht mit der Ausgabenhoheit und das Recht auf eigenverantwortliche Vermögensverwaltung. Die Einsetzung eines Spar- oder Staatskommissarsüber längere Zeit hinweg würde ebenfalls den Kernbereich der Finanzhoheit angreifen.
72Die Rechtsetzungs- oder Satzungshoheit (Autonomie) wird nach h. M. ebenfalls den Hoheitsrechten zugerechnet. Satzungen sollen ganz allgemein die Selbstverwaltungseinheiten instand setzen, ihre Aufgaben auch durch den Erlass abstrakt-genereller Anordnungen wirksam erfüllen zu können. Rechtsetzung muss aber grundsätzlich als ein staatliches Monopol angesehen werden. Es ist daher zweifelhaft, ob es sich hier um ein originäres, dem Selbstverwaltungsrecht innewohnendes Hoheitsrecht oder nur um eine staatliche Verleihunghandelt. Das BVerfG hat auch bis heute noch nicht entschieden, in welchem Umfang diese Befugnis zum Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung gehört. Aber selbst wenn Art. 28 Abs. 2 GG keine unmittelbare Autonomieverleihung beinhaltet, wäre der Landesgesetzgeber wegen der in diesem Artikel enthaltenen „ Regelungsbefugnis“ verpflichtet, den Kommunen das Satzungsrecht zuzugestehen.
73Satzungen gelten als Instrument einer dezentralisierten Rechtsetzung. Sie unterliegen nicht den Anforderungen des Art. 80 Abs. 1 GG, wohl aber dem allgemeinen Gesetzgebungsvorbehalt. Rechtsvorschriften dürfen damit das Satzungsrecht begrenzen.
V.Delegation gemeindlicher Hoheitsrechte
74Werden gemeindliche Aufgaben auf andere Personen des öffentlichen Rechts übertragen, müssen i. d. R. auch die notwendigen Hoheitsrechte übertragen werden (Delegation).
Solche Kompetenzverlagerungen berühren die Gebietshoheit und damit die Organisationsgewalt des Staates. Sie setzen daher eine gesetzliche Ermächtigung (z. B. GKZ, SchG oder § 59 GemO) und die Einhaltung bestimmter Formvorschriften voraus. Dabei wird gefordert, eine Vereinbarung in öffentlich-rechtlicher Form abzuschließen, sie von der Aufsichtsbehörde genehmigen und öffentlich bekannt machen zu lassen.
75Die Zuständigkeitsübertragung kann in der Form
– einer echten Delegationerfolgen (Übertragung erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen),
– oder unecht delegiertwerden (gegen den Willen der betroffenen Gemeinden – z. B. die zwangsweise Bildung eines Zweckverbandes oder die Kompetenz-Kompetenz der Landkreise nach § 2 Abs. 2 LKrO).
VI.Rechtsschutz der kommunalen Selbstverwaltung
1.Rechtsschutz auf europäischer Ebene
76Der Europäische Gerichtshof muss vom Anwendungsvorrang des Unionsrechts ausgehen und kann daher nicht das Unionsrecht am Maßstab des nationalen Rechts überprüfen. Eine Berufung auf europarechtlich anerkannte bzw. nunmehr in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRCh) verbürgten Grundrechte ist den Kommunen ebenfalls verwehrt, da sie auch auf europäischer Ebene nicht als Grundrechtsträger gelten. Eine Verfassungsbeschwerde gegenüber unionsrechtlichen Vorgabenist daher nur begrenzt und mittelbar durch eine verfassungsrechtliche Überprüfung der vom Bund erlassenen Umsetzungs- oder Ausführungsgesetze durch das BVerfG möglich.
2.Schutz durch das Bundesverfassungsgericht
77Der Bund ist über Art. 28 Abs. 3 GG verpflichtet, die Einhaltung von Art. 28 Abs. 1 und Abs. 2 GG durch die Länder zu gewährleisten. Auch deshalb ist den Gemeinden und Gemeindeverbänden über Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG i. V. m. § 91 und § 13 Nr. 8a BVerfGG das Recht auf kommunale Verfassungsbeschwerdeeingeräumt. Ihrem Wesen nach entspricht die kommunale Verfassungsbeschwerde eher einer abstrakten Normenkontrolle. Das BVerfG hält die Zulässigkeitsvoraussetzung des § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG (Vorrang der Fachgerichte bzw. Subsidiarität des Verfassungsrechtsweges) auch bei den kommunalen Verfassungsbeschwerden für zwingend. 61Einen solchen Vorrang der Fachgerichte eröffnet z. B. bei untergesetzlichen Rechtsnormen § 47 VwGO.
78Die Erhebung der kommunalen Verfassungsbeschwerde ist an die Jahresfristdes § 93 Abs. 2 BVerfGG gebunden. Sie kann gegen ein Gesetz des Bundes oder der Länder erhoben werden, das die Kommune selbst, gegenwärtig(also nicht nur zukünftig) und unmittelbar(also ohne Konkretisierung durch eine weitere Rechtsnorm) in ihren Selbstverwaltungsrechten verletzt. 62
79Gesetze in diesem Sinne sind alle vom Staat erlassenen Rechtsnormen, die Außenwirkungen gegen Gemeinden entfalten. 63In Ländern, die den Rechtsweg zum Landesverfassungsgericht (in Baden-Württemberg gem. Art. 76 LV an den Verfassungsgerichtshof in Stuttgart) eröffnet haben, kann eine solche Verfassungsbeschwerde nur gegen Bundesgesetze erhoben werden (Subsidiaritätsklausel). Dies ergibt sich so ausdrücklich aus dem Wortlaut von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG. Die Subsidiaritätsklausel reicht aber selbst nur so weit, wie der Rechtsweg zum Landesverfassungsgericht bezüglich des zur Überprüfung gestellten Gegenstands reicht. Da in Baden-Württemberg nur formelle Gesetze (Parlamentsgesetze) der Normenkontrolle des Art. 76 LV unterstellt werden können, bleibt gegen unterparlamentsgesetzliche Rechtsnormen, wie insb. Rechtsverordnungen, grundsätzlich die Möglichkeit der kommunalen Verfassungsbeschwerde an das BVerfG eröffnet. 64Beschwerdeberechtigt sind nur die Kommunen selbst, nicht aber einzelne Organe oder Organteile. Die Erhebung der kommunalen Verfassungsbeschwerdesetzt im Innenverhältnis jedoch einen entsprechenden Beschluss des Hauptorgans voraus. Von den Ländern erlassene weitergehende Selbstverwaltungsgarantien unterliegen allerdings dieser Gewährleistung nicht. Strittig ist, ob mit der kommunalen Verfassungsbeschwerde nur eine Verletzung des Art. 28 Abs. 2 GG oder auch anderer Normen des Grundgesetzes gerügt werden kann. Nach wohl h. M. müsste dies jedenfalls dann möglich sein, wenn diese Grundgesetzbestimmungen ihrem Inhalte nach das verfassungsrechtliche Bild der Selbstverwaltung mitbestimmen (z. B. die finanzverfassungsrechtlichen Bestimmungen des Grundgesetzes).
Читать дальше