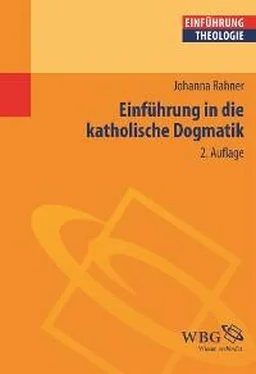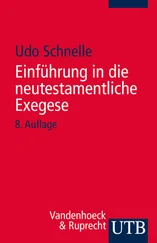Grenze
Der Glaube schafft sich ‚Schlagworte‘, und sein Bekenntnis hat primär einen liturgischen ‚Sitz im Leben‘. Während ein Glaubensbekenntnis ein Erkennungszeichen nach innen und Bekenntniszeichen nach außen hin ist, soll die Lehrformulierung die Glaubenslehre und ihre theologische Interpretation schützen und abgrenzen. Sie hat letztlich ‚konfessionsbildenden‘ Charakter. Sie ist eine negativ abgrenzende ‚Krisenmaßnahme‘ der Kirche.
Resümee
Das Dogma ist, positiv betrachtet, das Resümee einer neuen Erfahrung der Kirche im Umgang mit der zum Verstehen aufgegebenen Heilsbotschaft zu einer bestimmten geschichtlichen Stunde , und hat darum unmittelbar verpflichtende Bedeutung für den persönlichen Glauben für die Dauer dieser geschichtlichen Stunde.
Kontextualität
Ein Dogma ist eine nachträgliche Definition. Während am Anfang der Versuch steht, den Glauben in neuer ‚Sprache‘ zu verkündigen, kommt am Ende der Zeitpunkt, diese Versuche auf den richtigen, verbindlichen sprachlichen ‚Nenner‘ zu bringen. Dieses Vorgehen bindet sich an eine konkrete, unmittelbare, zeitbedingte Erfahrung der Kirche zu einer konkreten Stunde und an einem konkreten Ort (Ort-/Horizont- und Zeitbedingtheit) . Mittelbare Bedeutung behält jedes Dogma, weil es den verbindlichen Weg des Glaubens zeigt.
menschliches Wort – Wahrheit Gottes
Auch abgesehen von der geschichtlichen Bedingtheit jeder dogmatischen Formel ist kein menschliches Wort je imstande, die Fülle der Wahrheit Gottes anders als nur gebrochen wiederzugeben.
Jeder menschliche Satz über Gott muss notwendig hinter der vollen Wahrheit Gottes zurückbleiben. Er ‚leidet unter der Differenz von Aussage und Aussageabsicht‘ und ist nicht einfach und bruchlos von einem Sprachhorizont in den anderen übersetzbar ([1] 32f.). So entscheidet bei einem Glaubenssatz weniger seine theoretische‘ Richtigkeit als sein wirklicher Gebrauch. Die entscheidende Frage ist nicht die theoretische Frage nach der Irrtumsfähigkeit eines Dogmas, sondern die praktische Frage, was denn zu tun ist, wenn ein Dogma das nicht (mehr) leistet, was es leisten soll.
Dogmengeschichte
Die Dogmengeschichte ist kein Prozess kontinuierlich fortschreitender, immer vollkommenerer Formulierung der Glaubenswahrheit . Die Einheit der Dogmengeschichte gründet nicht in einem sich gleich bleibenden, zeit- und geschichtsüberlegenen, alles zusammenfassenden ‚Supersatz‘, sondern in der Bindung des Lebens an einen, in Christus an uns handelnden Gott, in welchen Formeln sich diese Bindung auch immer ausdrücken mag.
Wegweiser
Die Entwicklungsgeschichte der Dogmen ist kein ständiger Fortschritt, weil sie eher durch neue Situationen, durch neue Zeiten, neue Orte erzwungen sind und sehr häufig einfach mit dem, was vorher war, brechen. Sie zeigen je eigene Akzente, die sich aus der Stunde selbst und den je eigenen Verstehensbedingungen ergeben. Die Dogmengeschichte ist zu verstehen als ein gewundener Weg mit mancherlei Umwegen, aber auch als Summe der Wegweiser, die den Weg unseres Glaubens für ein je begrenztes Teilstück kennzeichnen und damit richtungsweisend sind. Einheit und Kontinuität der Dogmengeschichte sind keine theoretisch nachrechenbare Sache. Man kann ihre Entwicklungslinien nie theoretisch bestimmen oder vorhersagen, weil sie zu sehr vom lebendigen Glaubensvollzug und von den lebendigen Erfahrungen des Glaubens mitbestimmt sind.
b) Hermeneutische Grundregeln
Auslegungskriterien
Aus den genannten Abgrenzungen lassen sich nun grundlegende Auslegungskriterien ableiten ([16] 732–743; [5]), die den Weg zwischen Verbindlichkeit und Bedingtheit weisen.
(1) Dogmen sind keine Crund- oder Ausgangssätze theologischer Arbeit, sondern sie sind so etwas wie eine ‚Wasserwaage‘ , die nachträglich an das Ergebnis theologischer Überlegungen anzulegen ist.
(2) Ein Dogma ist anzunehmen als verbindliches Zeugnis der Geschichte unseres Glaubens . Wir Heutigen haben Solidarität aufzubringen mit den Menschen, die uns in geschichtlich vergangenen Zeiten mit dem Versuch vorangegangen sind, um das Verständnis des Handelns Gottes an uns und unsere Hingabe an Gott zu ringen. D.h. ein Dogma verpflichtet uns durch den gemeinsamen Versuch unseren Glauben im Wandel derzeitgeschichtlichen Situationen zur Sprache zu bringen.
(3) Im Umgang mit dem überlieferten Dogma ist unsere eigene Situation nicht als Störung zu betrachten, sondern als Aufgabe anzunehmen. Jeder Christ hat also an der Formulierung heutiger Glaubenserfahrung mitzuarbeiten, denn schließlich geht es um unseren Glauben in unserer Zeit.
(4) Der ursprüngliche Ort des Dogmas im liturgischen Bekenntnis stellt die Aufgabe, gerade heute darauf zu achten, dass die theologische und zuletzt dogmatische Formulierung in einer unserem Denken angepassten Bekenntnissprache geschieht.
(5) Der Erkenntniswert der Form des Dogmas hängt davon ab, wie sehr es dazu beiträgt, die ‚Wahrheit‘ des in Jesus Christus geschehenen Handelns Gottes an uns erkennbare Wirklichkeit werden zu lassen. Ein Dogma ist daran zu messen, ob und wie es auch heute noch zum Glauben führt . Gerade weil es geschichtlich bedingte Sätze sind, die zum Glauben zu bringen versuchen, muss ihre Sprache daran gemessen werden, wie sehr dies ihnen auch heute noch gelingt.
(6) Bei der Verkündung eines neuen Dogmas (oder der Einschärfung eines alten) ist die allgemeine Zustimmung zu dem, ‚was die Kirche glaubt‘ , selbstverständlich aufgrund der Rückbindung des persönlichen Glaubens an die Gemeinschaft der vor mir schon Glaubenden. Die persönliche Integration des (neuen) Dogmas in den gläubigen Lebensvollzug ist aber ebenso unerzwingbar wie der Glaube selbst.
(7) Dabei ist die Forderung nie aufzugeben, dass die Lehrverkündigung des kirchlichen Amtes auch wirklich ein Resümee der Glaubenserfahrung der ganzen Kirche zur Sprache bringt und so hat man sich dafür einzusetzen, dass in der Kirche Verfahrensweisen entwickelt werden, die diese Resümeefunktion gewährleisten, soweit menschliche Schwachheit und Beschränktheit das nur irgendwie zulassen (s. IV.8).
3. Dogmatik als Denkformanalyse
Sitz im Leben
Kirchliches Zeugnis geschieht immer für eine bestimmte Zeit, an einem bestimmten Ort für eine bestimmte Gruppe von Menschen, hat einen konkreten ‚Sitz im Leben‘, weil die Botschaft es wert ist, gerade hier und jetzt diesen Menschen gesagt zu werden ([14] 167). Neue Situationen der Überlieferungsgeschichte ergeben neue Fragen und neue Antworten, neue Einsichten setzen sich durch; und erst in diesem ganzen Spektrum der Entwicklung kommt die Vielfalt und Breite der Wahrheit durch. Nicht die Wahrheit wächst, aber die Erkenntnis. Das bedeutet aber, dass die geschichtlichen Etappen unserer Glaubensüberlieferung für uns heute noch relevant sind und für unsere heutige Vergegenwärtigung und Bezeugung nicht einfach ausgeklammert werden dürfen ([14] 167). Weil Glaubensüberlieferung in Bekenntnis und praktischem Lebenszeugnis vergegenwärtigt wird, muss sie je neu angeeignet werden. Aneignung ist die je eigene, neue Interpretation der schon interpretierten Glaubenswahrheit, zugleich wandert in diese Aneignung immer das je aktuelle Denken des Menschen ein. Aneignung ist daher die Vermittlung von gegenwärtigem Bewusstsein und überlieferter Glaubenswahrheit.
Denkform
Die Überlieferung unseres Glaubens bedeutet immer schon ‚Kontinuität im Wandel‘. Überlieferung ist lebendige Auslegung in stets neue, andere Lebenswelten hinein. Jede Zeit und Kultur hat dabei ihre besonderen Denkarten und Denkformen. Denkformen sind bestimmte Verstehenshorizonte einer Zeit. Sie spiegeln ein bestimmtes Selbstverständnis, ein Vorverständnis, das bestimmte Weisen des Denkens, Erkennens und Sprechens im Voraus festlegt. Bestimmte begegnende Inhalte werden aus diesem Vorverständnis heraus erkannt, verstanden und angeeignet. Zugleich kann Neues, das kennen gelernt wird, das eigene Verständnis, die Denkform verändern. Die ‚Wahrheit‘ des Glaubens wird in verschiedensten Denkformen überliefert, darin verstanden und zur Aneignung ausgelegt. Aneignung bedeutet Übersetzung in die je eigene Denkform und Lebenswelt. Fragen treten ins Blickfeld, die vorher noch nicht an der Tagesordnung waren. Gefundene Antworten müssen stets gerade im Horizont der jeweiligen Denkform verstanden werden. Nur so wird klar, was sie aussagen wollten und was sie aussagen konnten. D.h. man versteht heute nur richtig, wenn die frühere Denkform verstanden ist. So gelingt es, über die je verschiedenen Denkformen und ihre gegenseitige Verbindung so etwas wie die Identität der Glaubenswahrheit zu entdecken.
Читать дальше