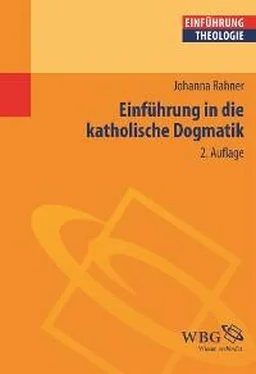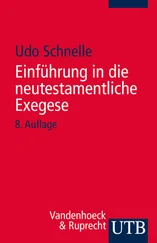Johanna Rahner - Einführung in die katholische Dogmatik
Здесь есть возможность читать онлайн «Johanna Rahner - Einführung in die katholische Dogmatik» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Einführung in die katholische Dogmatik
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Einführung in die katholische Dogmatik: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Einführung in die katholische Dogmatik»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Einführung in die katholische Dogmatik — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Einführung in die katholische Dogmatik», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
a) Leib, Seele, Unsterblichkeit
b) Gericht
c) Fegfeuer/Läuterung
d) Himmel und Hölle
Literatur
Register
Vorwort
Von Karl Barth soll der Satz stammen, dass man eine Einführung in die Dogmatik erst am Ende eines Forscherlebens schreiben kann und sollte. Die hier vorgelegte Einführung hat sich nicht an diesen Ratschlag gehalten. Das liegt u.a. daran, dass sie ihr Ziel nicht darin sucht, die katholische Dogmatik schlechthin vor- und darzustellen, sondern nur eine erste Orientierung in, ein einleitendes Vertrautwerden mit und eine Grundlegung von Methode und Themen katholischer Dogmatik bieten möchte. Sie versucht also erste Schneisen ins Dickicht der Dogmatik zu schlagen, die gerade Studienanfängern der Theologie und interessierten Laien hilfreich sein können. Obgleich sie ihre konfessionelle Prägung nicht ablegen kann, versteht sich die hier vorgelegte Einführung dennoch als eine ökumenisch sensible Hinführung zu jenem Ringen um ein verbindliches Verstehen unseres Glaubens, das jenseits aller Konfessionsgrenzen Anliegen und Ziel der Dogmatik zu sein hat.
Auch dieses Buch ist nicht ohne vielfältige Mithilfe und Unterstützung entstanden. Den Anregungen des Lektors der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Herrn Dr. Bernd Villhauer, ist die Idee der Gestaltung dieses Projekts zu verdanken. Ohne die zahlreichen Anregungen, den regen Gedankenaustausch und die konstruktive Kritik meines Mitarbeiters Erik Müller-Zähringer wäre das Buch in der vorliegenden Form nicht zustande gekommen. Während die Mühe der Manuskripterstellung in den bewährten Händen meiner Sekretärin, Frau Margit Müller, lag, haben Frau Dipl. theol. Maria Theresia Zeidler, MA, sowie Herr cand. theol. Florian Kleeberg, Herr cand. theol. Christian Henkel und Frau cand. theol. Elisabeth Preiß die Last des Korrekturlesens und der Registererstellung auf sich genommen. Gewidmet sei dieser Band den Studierenden der (nun ruhenden) Katholisch-theologischen Fakultät der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, die die Entstehung dieser Einführung ganz lebendig und praktisch begleitet haben.
Bamberg, am Fest des Hl. Hieronymus 2007
Johanna Rahner
Vorwort zur zweiten Auflage
Dass nach sechs Jahren eine ‚Einführung‘ im Bereich der katholischen Dogmatik in die zweite Auflage geht, bescheinigt ihr ein wenig die erhoffte Wirkung: Sie ist nützlich für die Praxis und wird ge- und benutzt. Mit Blick auf diese Nützlichkeit und Nutzbarkeit wurde die Konzeption als Ganze beibehalten, aber einige kurze Passagen bearbeitet bzw. ergänzt, sowie die entdeckten Fehler beseitigt.
Das erneute Korrekturlesen lag diesmal in den bewährten Händen von Frau stud. theol. Franziska Luksch.
Gewidmet sei die 2. Auflage den Studierenden des Instituts für katholische Theologie an der Universität Kassel. Sie sind stets eine Herausforderung und nötigen zum Nachdenken darüber, worauf es beim Theologietreiben wirklich ankommt.
Kassel, am Fest des seligen Johannes XXIII.
Johanna Rahner
A. Allgemeine Dogmatik
I. Was ist eigentlich ‚Dogmatik‘?
1. Einführen – wozu, wohin?
Prolegomena
Ein international bekannter Verlag für Reiseführer bewirbt seine Bücher mit dem Slogan: ‚Man sieht nur, was man kennt!‘ Dieses Motto kann mit guten Gründen auch über einer Einführung in die katholische Dogmatik stehen. Wozu dient die vorliegende Einführung? Sie führt in die Sitten und Gepflogenheiten der Disziplin, d.h. in Methodik und Themen ein. Sie sondiert das Gelände, noch bevor allzu viele touristische Details – also all das, was Monographien zu Einzelthemen und Traktaten der Dogmatik in Fülle liefern –, den Blick für die Grundlagen und Grundfragen verstellen. Diese Sondierungen beinhalten jene Vor- und Einführungsfragen, die Prolegomena zur Dogmatik, und jene methodischen Grundlagen, die in jeder einzelnen Spezialvorlesung der Dogmatik vorausgesetzt sind bzw. sich dort mitunter bis in Einzelprobleme hinein auswirken.
Wie gelingt es einer Einführung nun, mehr als staubtrockene Theorie zu sein? Am besten dadurch, dass sie ihre Aufgabe sowohl als Suche nach den Grundprinzipien als auch als Klärung der Grundfragen der Dogmatik angeht. Eine Einführung ist also so etwas wie eine Prinzipien- und Sprachlehre der Dogmatik. Welches sind aber nun die Grundpfeiler, die Grundprinzipien der Dogmatik? Und wo hinein wird eingeführt? Die zentrale Frage lautet: Was ist eigentlich Dogmatik ?
a) Eine erste Definition (vgl. [3] 1)
Dogmatik ist eine an der Übersetzung der traditionellen Glaubensinhalte orientierte Disziplin, die ausgehend von den primären und sekundären Quellen des Glaubens und im Horizont eines modernen Welt- und Selbstverständnisses des Menschen zu einem verbindlichen Verständnis des Glaubens kommt. Sie arbeitet dabei unter wissenschaftlichem Anspruch und mit den ihrer Wissenschaftlichkeit entsprechenden Kriterien und Methoden.
den Glauben rational verantworten
Eine erste Aufgabe der Dogmatik ist es, den christlichen Glauben zu verstehen. Ihr Thema sind also nicht einfach nur die Dogmen – also das, was irgendwann einmal offiziell als Glaubensinhalt festgelegt wurde und in einem bestimmten Wortlaut definiert wurde (s. II) –, sondern der christliche Glaube als ganzer. Der christliche Glaube steht freilich nicht als Glaubensvollzug, Glaubenspraxis oder Glaubensverkündigung im Mittelpunkt des Interesses der Dogmatik. Es geht um die intellektuelle Annäherung an den Glauben und den rational vernünftigen Umgang mit dem Glauben . Dieses ‚Verstehen‘ ist kein allgemeines Verstehen, sondern ein verbindliches Verstehen. Was bedeutet das?
verbindliches Verstehen
Christlicher Glaube hat den Anspruch, Offenbarung , Tat Gottes zu sein ([5]). Nicht irgendwelche verpflichtenden kirchlichen Instanzen, wie Papst, Bischöfe etc., machen die Verbindlichkeit des Glaubens aus, sondern der Glaube selbst fordert von seinem Ursprung her Geltung, Anerkennung, Verbindlichkeit (s. III.1) (vgl. [3] 4), die eine persönliche und eigenständige Antwort des Menschen erfordern. Eine verbindliche Auslegung des Glaubens hat daher dafür zu sorgen, dass diese Herausforderung auch in angemessener Weise ankommt. Eine verbindliche Auslegung des Glaubens beschäftigt sich daher nicht nur mit dem Vergangenen, sondern soll den Glauben hier und jetzt zur Entscheidung vorlegen ([3] 5).
b) Zur Methode katholischer Dogmatik
Der Mensch als Hörer des Wortes
Der Mensch ist kein Objekt, das übernatürlich ergehende Offenbarungswahrheiten Gottes einfach zu empfangen und zu glauben hat, sondern er ist das ‚Du‘ Gottes, das durch die Ansprache von Gott als ‚Hörer/Hörerin des Wortes‘ zur Antwort herausgefordert ist. Dieser in der katholischen Theologie des 20. Jahrhunderts vollzogene Perspektivenwechsel hin zum Offenbarungsmodell der Selbstmitteilung Gottes (s. III.4) führt zu einem veränderten Selbstverständnis wie zu einer methodischen Revision der Dogmatik als theologische Kerndisziplin.
transzendentale Anthropologie
Die Dogmatik hat nun die Aufgabe, über das Wort, den Glauben, seine Inhalte und über das Vorverständnis auf Seiten der Hörenden und über die Bedingungen und Möglichkeiten des Zum-Glauben-Kommens und Glauben-Könnens nachzudenken. Sie ist daher die Auslegungswissenschaft (Hermeneutik) des Glaubens für die moderne Zeit. Zugleich hat sie die theologische Analyse aktueller menschlicher Existenz zu leisten ([2] 217). Über den christlichen Glauben nachzudenken, bedeutet auch über den Menschen als Hörer dieser Botschaft nachzudenken, nach den Vorbedingungen und nach den Vorfragen für den Glauben auf Seiten des Menschen zu fragen, also eine transzendentale Anthropologie zu betreiben. Das bedeutet, „dass man eben bei jedem dogmatischen Gegenstand nach den notwendigen Bedingungen seiner Erkenntnis im theologischen Subjekt mitfragt; nachweist, dass es solche apriorischen Bedingungen gibt; zeigt, dass sie selbst schon über den Gegenstand, die Weise, die Methode und die Grenzen seiner Erkenntnis etwas implizieren und aussagen“ ([9] 44). Immanuel Kants (1724–1804) ‚kopernikanische Wende‘ der Erkenntnistheorie (vgl. Kritik der reinen Vernunft B XVI–XVII) hält Einzug in die Dogmatik (Wende zur Anthropologie) . Diese Methode in der Dogmatik anzuwenden, bedeutet über den Zusammenhang zwischen den dogmatischen Aussagen und der menschlichen Erfahrung und Existenz nachzudenken. Dies gilt nicht nur für die Gestalt und den Inhalt des Glaubens hier und jetzt, sondern auch für jede Phase der geschichtlichen Entwicklung des Glaubens. Damit ist auch die Idee einer menschlichen Geschichte der Glaubensentwicklung, einer Dogmengeschichte und Dogmenhermeneutik zu verbinden (vgl. u. II.1–3), die nicht nur rückblickend, sondern auch zukünftig zu einem dynamischen Verständnis des Glaubens führt. Eine transzendental arbeitende, anthropologisch orientierte Dogmatik sucht nach der Bedingung der Möglichkeit des Glaubens, der Beziehung zu, ja einer Hinordnung auf Gott. Im Sinne Karl Rahners (1904–1984) ist es gerade die besondere Aufgabe einer Grundlegung der Dogmatik, dass sie diese anthropozentrische Dimension der ganzen Theologie herausarbeitet, methodisch beschreibt und zugleich zeigt, inwiefern daher die Inhalte des christlichen Glaubens vertrauens- und glaubwürdig sind.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Einführung in die katholische Dogmatik»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Einführung in die katholische Dogmatik» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Einführung in die katholische Dogmatik» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.