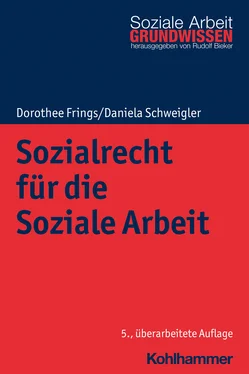1.6.3 Subsidiaritätsprinzip
Für die Erbringung von Sach- und Dienstleistungen räumt das sog. Subsidiaritätsprinzip den freien Trägern einen begrenzter Vorrang vor den öffentlichen Trägern ein. Traditionell – vor allem im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe – handelte es sich dabei um frei-gemeinnützige Träger. In der jüngeren Vergangenheit wächst aber daneben die Bedeutung der privat-gewerblichen Leistungserbringer. Für die Jugendhilfe findet sich das Subsidiaritätsprinzip in § 4 Abs. 2 SGB VIII, für die Sozialhilfe in §§ 5 Abs. 4, 75 Abs. 2 SGB XII, für die Eingliederungshilfe in § 124 Abs. 1 SGB IX und für die Arbeitsmarktintegration von Leistungsberechtigten nach SGB II in § 17 Abs. 1 SGB II. Es gilt das Prinzip:
Neue Dienste soll der kommunale öffentliche Träger nur schaffen, wenn die frei gemeinnützigen Träger nicht in der Lage sind, ein geeignetes und ausreichendes Angebot zu gewährleisten.
Bereits bestehende Dienste darf der öffentliche Träger fortführen (BVerfG v. 18.7.1967 – 2 BvF 3-8/62).
In der Stadt B gibt es noch keine Schuldnerberatungsstelle. Die Diakonie bietet – als bislang einziger Träger – an, eine solche einzurichten. Sie hat ein Konzept vorgelegt und will drei Fachkräfte beschäftigen.
Der Stadtrat beschließt, lieber eine eigene kommunale Beratungsstelle einzurichten, weil so kommunale Bedienstete beschäftigt werden können, deren Stellen abgebaut werden sollen.
Kann sich die Diakonie gegen diese Entscheidung wehren?
Es handelt sich bei der Diakonie um einen Wohlfahrtsverband und damit um einen frei gemeinnützigen Träger. Sie hat ein Angebot vorgelegt, um einen Sozialdienst auf kommunaler Ebene zu schaffen. Die Kommune ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung die Möglichkeit einer Schuldnerberatung zu gewährleisten (ergibt sich aus § 11 Abs. 5 SGB XII). Da die Aufgabe von einem freien Träger übernommen werden kann, soll die Kommune keine eigenen Dienste schaffen. Für den Bereich der Sozialhilfe wird dies ausdrücklich in § 5 Abs. 4 und § 75 Abs. 2 SGB XII geregelt.
Hat die Kommune bereits selbst eine Schuldnerberatung eingerichtet (weil kein Angebot der freien Wohlfahrtspflege zu erhalten war), so darf sie ihre Einrichtung fortführen, auch wenn später ein frei gemeinnütziger Träger bereit ist, selbst eine Beratungsstelle einzurichten.
Da derzeit noch keine Schuldnerberatung der Kommune besteht, kann die Diakonie verlangen, dass die Stadt die Einrichtung einer Schuldnerberatung unterlässt und stattdessen das Angebot der Diakonie fördert.
Die Förderung eines freien Trägers kann auch neben dem Angebot des öffentlichen Trägers erforderlich werden, wenn ein nicht abgedeckter Bedarf besteht. Im Bereich der Jugendhilfe haben die freien Träger einen Rechtsanspruch auf die Prüfung der Förderung ihrer Angebote unter Berücksichtigung des Gleichheitssatzes nach Art. 3 Abs. 1 GG. Der öffentliche Träger kann aber im Rahmen seiner Planungsverantwortung bestimmte Prioritäten setzen, die in einem Gesamtkonzept nach sachgerechten Kriterien festgelegt sein müssen (BVerwG v. 17.7.2009 – 5 C 25/08). Auf den Abschluss von Leistungs- und Entgeltvereinbarungen (§§ 78a ff. SGB VIII) haben die freien Träger einen Rechtsanspruch; dies gilt ebenso für Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen im Bereich der Sozialhilfe (§§ 75 ff. SGB XII) und der Eingliederungshilfe (§§ 123 ff. SGB IX).
Das Prinzip stammt aus der katholischen Soziallehre, findet seine Wurzel aber in der Antike, und ist auch in der calvinistischen Gegenbewegung gegen die zentralistische Struktur der katholischen Kirche zu finden.
Ausgedrückt wird ein gesellschaftliches Prinzip, welches der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung des Einzelnen, aber auch der selbst organisierten solidarischen Unterstützung größtmögliche Entfaltungsspielräume in einem Staatswesen einräumt.
Eine (öffentliche) Aufgabe soll vorrangig von der unteren Ebene bzw. kleineren Einheit wahrgenommen werden.
Zugleich verpflichtet dieses Prinzip die höheren Instanzen zur Unterstützung der unteren Instanzen, wenn diese ein soziales Problem nicht aus eigener Kraft zu lösen vermögen.
Der Begriff findet sich auch an anderen Stellen des (Sozial-)Rechts. Wichtig ist er auch für das Verhältnis der EU zu den einzelnen Mitgliedstaaten. Die EU darf nur tätig werden, wenn die Maßnahmen der Mitgliedstaaten nicht ausreichen und wenn die politischen Ziele besser auf der Gemeinschaftsebene erreicht werden können.
Schon die oben beschriebene Gestaltung der Beziehungen zwischen den öffentlichen und den freien Trägern zeigt, dass zwischen beiden ein Verhältnis besteht, welches nicht als eine »Leistung im Auftrag« beschrieben werden kann.
Wichtige Grundlage für die Gestaltung sozialer Dienstleistungen in Deutschland ist das Recht auf Selbstbestimmung der freien Träger als Leistungserbringer, auch dann, wenn ihre Tätigkeit durch den öffentlichen Leistungsträger finanziert wird. Die Trägerautonomie wird von der Verfassung geschützt. Art. 19 Abs. 3 GG garantiert die Grundrechte nicht nur den einzelnen Menschen, sondern auch Vereinigungen und allen Formen von Zusammenschlüssen von Personen. Das wichtigste Grundrecht für die freien Träger ist das Recht aus Art. 2 Abs. 1 GG, eigenständig über ihre Handlungen zu entscheiden. Weitere konkrete Grundrechte sind die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), Religionsfreiheit (Art. 4 GG), Berufsfreiheit (Art. 12 GG) und der Schutz des Eigentums (Art. 14 GG). Für die kirchlichen Wohlfahrtsverbände ist das Recht auf Selbstbestimmung zusätzlich durch Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 und 5 Weimarer Reichsverfassung geschützt.
Das Verhältnis von Staat und Religion ist in Deutschland durch eine historisch gewachsene Ausformung geprägt, die einen Zwischenweg zwischen dem Staatskirchenmodell und dem Laizismus (rigorose Trennung zwischen Kirche und Staat) wählt. Den Religionsgemeinschaften wird eine verfassungsrechtlich garantierte Sonderstellung eingeräumt, die ihnen innerhalb der Schranken der geltenden Gesetze das Recht gewährt, ihre Angelegenheiten ohne staatliche Einmischung selbständig zu regeln. Das Grundgesetz hat das erstmals in der preußischen Verfassung von 1848 (Art. 12) festgelegte und durch alle weiteren Verfassungen übernommene Kirchenprivileg unmittelbar aus der Weimarer Verfassung übernommen (Art. 140 i. V. m. Art. 137 Abs. 3 WRV). Das Selbstbestimmungsrecht erfasst nicht nur die Religionsgesellschaften selbst, sondern auch alle ihnen zugeordneten Einrichtungen unabhängig von der Rechtsform, wenn sie sich nach ihrem religiösen Selbstverständnis dazu berufen fühlen, ein Stück des Auftrags der Kirche in dieser Welt zu übernehmen, sowie alle Vereinigungen, die sich die gemeinsame Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen. Damit werden auch die christlichen Wohlfahrtsverbände vom Kirchenprivileg erfasst (siehe BVerfG v. 22.10.2014 – 2 BvR 661/12).
Auch wenn freie Träger durch ihre Arbeit öffentlich-rechtliche Leistungsansprüche, z. B. im Bereich der Wohnungslosenhilfe (§ 67 SGB XII), erfüllen, werden sie dadurch nicht zum Teil der Sozialverwaltung oder deren Erfüllungsgehilfen.
»Die staatliche Zuwendung ist nämlich kein Akt der Beleihung. … Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege bleiben gerade hierbei Erfüller staatsunabhängiger, von ihnen selbst definierter Aufgaben.« (BVerfG v. 17.10.2007 – 2 BvR 1095/05)
Als allgemeine Regelung für alle Sozialleistungen legt § 17 Abs. 3 Satz 2 SGB I fest, dass die freien Träger einen Anspruch auf die selbstbestimmte Durchführung ihrer Aufgaben haben und damit nicht den Weisungen der öffentlichen Träger unterliegen (für die Jugendhilfe: § 4 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII; für die Sozialhilfe § 5 Abs. 2 Satz 2 SGB XII). Das Recht des öffentlichen Trägers auf Kontrolle einer Institution, die mit öffentlichen Aufgaben beauftragt wurde (§ 97 SGB X), findet auf freie Träger ausdrücklich keine Anwendung (§ 17 Abs. 3 Satz 4 SGB I).
Читать дальше