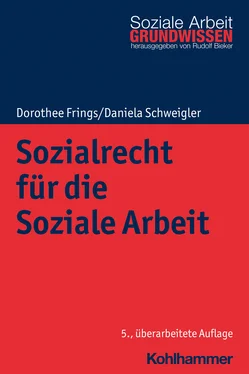• Ermessensüberschreitung: Es wird eine Rechtsfolge gewählt, die von der Ermessensnorm nicht gedeckt ist.
Einer Sozialhilfeempfängerin wird für die Kosten im Zusammenhang mit der Hochzeit ihrer Tochter nach § 37 Abs. 1 SGB XII eine Beihilfe statt eines Darlehens gewährt, weil auf Grund der Umstände ein Ausnahmefall vorliege. Das Sozialamt hat die Regelung falsch ausgelegt, eine Beihilfe darf es nicht bewilligen. Das »sollen« bezieht sich nur auf die Gewährung eines Darlehens.
• Ermessensfehlgebrauch:
− Mangelnde Würdigung des Sachverhalts, z. B. werden bei einem 4-jährigen Kind trotz entsprechenden Vorbringens der Eltern nicht alle Umstände berücksichtigt, die einen besonderen Bedarf begründen können, neben der Kita ergänzend durch eine Tagesmutter gefördert zu werden (§ 24 Abs. 3 Satz 3 SGB VIII).
− Unsachliche Gesichtspunkte, z. B. wird eine Leistung mit der Begründung abgelehnt, das vorgesehene Budget des Leistungsträgers sei ausgeschöpft. Mit diesem Argument würde bei gleichem Sachverhalt einigen Personen die Leistung gewährt und anderen ohne sachliche Rechtfertigung nicht.
− Fehlende Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse, z. B. wird die Übernahme von Mietrückständen abgelehnt, weil diese selbstverschuldet seien, ohne zu berücksichtigen, dass zwei Kleinkinder im Haushalt leben.
− Verstoß gegen (höherrangige) Rechtsnormen, z. B. wird eine Weiterbildungsmaßnahme von der Arbeitsagentur abgelehnt, weil die Antragstellerin wegen ihrer Behinderung »schwer vermittelbar« sei. Hier liegt ein Verstoß nicht nur gegen das Diskriminierungsverbot des § 19a SGB IV vor, sondern auch gegen Art. 3 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes, das als höherrangiges Recht stets zu berücksichtigen ist. Ermessensentscheidungen sind stets auch an den Grundrechten zu messen.
In bestimmten Fällen kann das Ermessen auch auf Null reduziert sein, wenn jede denkbare andere Entscheidung einen Ermessensfehler, insbesondere einen Verstoß gegen Grund- oder Menschenrechte beinhalten würde.
Franca und ihre beiden Kinder (vier und sechs Jahre) sind seit längerer Zeit im Leistungsbezug nach dem SGB II. Am 23.3.2021 teilt Franca der Bearbeiterin beim Jobcenter mit, dass sie ab dem 1.4.2021 eine Stelle als Sachbearbeiterin antreten wird, mit deren Gehalt der gesamte Lebensunterhalt für sie und ihre Kinder gedeckt sein wird. Die erste Gehaltszahlung wird sie Ende April erhalten. Damit entfällt der Leistungsanspruch ab dem 1.4.2021. Franca hat jedoch nach § 24 Abs. 4 SGB II einen Ermessensanspruch auf Leistungen für April als Darlehen.
Falls Franca über keinerlei Rücklagen verfügt und deshalb den Lebensunterhalt für sich und die Kinder im April nicht sicherstellen könnte, bleibt bei der Ausübung des Ermessens kein Ermessensspielraum (Reduzierung auf Null), weil sonst gegen die Verpflichtung des Sozialstaats auf Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 GG (Menschenwürde) i. V. m. Art. 20 Abs. 1 GG (Sozialstaatsprinzip) verstoßen würde.
Ein Ermessensfehler führt zu einer rechtswidrigen Entscheidung, die der Bürger mit Rechtsmitteln angreifen kann. Damit ein Ermessensfehler tatsächlich aufgedeckt werden kann, müssen aus einer schriftlichen Entscheidung (wenn diese die Bürgerin belastet) die Gründe hervorgehen, auf denen die Entscheidung beruht (§ 35 Abs. 1 SGB X). Bei einer mündlichen Entscheidung kann der Bürger unverzüglich eine schriftlich begründete Ausfertigung verlangen (§ 33 Abs. 2 Satz 2 SGB X).
1.6 Das Verhältnis zwischen öffentlichen und freien Trägern bei der Erbringung von Sozialleistungen
Obwohl allein öffentliche Träger in der gesetzlichen Leistungsverpflichtung stehen, werden die sozialen Dienstleistungen überwiegend nicht von öffentlichen, sondern von sog. freien Trägern erbracht.
1.6.1 Begriffe: freie – gemeinnützige – gewerbliche Träger – Leistungserbringer
Der Begriff der »freien Träger« wird uneinheitlich benutzt. Traditionell waren damit die gemeinnützigen Wohlfahrtsträger gemeint, die in den großen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege organisiert sind (Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Rotes Kreuz und Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland). Mittlerweile ist die Trägerlandschaft jedoch vielfältiger geworden und umfasst auch viele neue Anbieter sozialer Dienstleistungen. Dazu gehören kleine Vereine ebenso wie sehr große Konzerne, gemeinnützige ebenso wie gewerbliche Träger. Viele gewerbliche Träger in den Bereichen der Pflege, der Jugendhilfe und der Leistungen für Menschen mit Behinderungen sind im Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) organisiert.
Gewerbliche Träger stehen bisweilen im Ruf, auf ein Gewinnstreben ausgerichtet zu sein, das mit den ethischen Grundsätzen der Sozialen Arbeit nicht vereinbar sei. In der Realität finden sich allerdings so unterschiedliche Ansätze und Motive für die Tätigkeit der gewerblichen Träger, dass ihnen keineswegs allgemein ein geringeres Engagement oder ein mangelndes soziales Interesse unterstellt werden kann. Umgekehrt sind auch die klassischen Wohlfahrtsorganisationen keineswegs vor ethisch und rechtlich fragwürdigen Praktiken gefeit, wie wiederholte Finanzskandale gezeigt haben. Pauschale Zuschreibungen sind daher hier (wie auch sonst) nicht hilfreich.
Im Sozialrecht spielt die Frage der Gemeinnützigkeit nur in einigen Teilbereichen eine Rolle, so etwa in der Jugendhilfe im Bereich der längerfristigen Förderung von Trägern (§ 74 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII) und bei der Beteiligung in der Jugendhilfeplanung (§§ 78, 80 SGB VIII). Grundsätzlich sind gemeinnützige und gewerbliche Träger aber in ihrer Rolle als Anbieter sozialer Dienstleistungen in derselben Rolle im Verhältnis zum öffentlichen Träger. Zunehmend setzt sich hierfür der Begriff der Leistungserbringer durch.
In diesem Buch sind mit den »freien« alle nicht-öffentlichen Träger gemeint, unabhängig von ihrer Rechtsform und einer gemeinnützigen oder gewerblichen Ausrichtung. In diesem Sinne wird der Begriff der freien Träger gleichbedeutend mit Leistungserbringer benutzt.
1.6.2 Gesamtverantwortung und Trägerpluralität
Die Einbindung der freien Träger in die sozialstaatliche öffentliche Verantwortung umschreibt das Bundesverfassungsgericht in einer Grundsatzentscheidung von 1967 wie folgt:
»Wenn Art. 20 Abs. 1 GG ausspricht, dass die Bundesrepublik ein sozialer Bundesstaat ist, so folgt daraus nur, dass der Staat die Pflicht hat, für einen Ausgleich der sozialen Gegensätze und damit für eine gerechte Sozialordnung zu sorgen; dieses Ziel wird er in erster Linie im Wege der Gesetzgebung zu erreichen suchen. Keineswegs folgt aus dem Sozialstaatsprinzipp, dass der Gesetzgeber für die Verwirklichung dieses Ziels nur behördliche Maßnahmen vorsehen darf. Art. 20 Abs. 1 GG bestimmt nur das ›Was‹, das Ziel, die gerechte Sozialordnung; er lässt aber für das ›Wie‹, d. h. für die Erreichung des Ziels, alle Wege offen. Deshalb steht es dem Gesetzgeber frei, zur Erreichung des Ziels auch die Mithilfe privater Wohlfahrtsorganisationen vorzusehen.« (BVerfG v. 18.7.1967 – 2 BvF 3/62)
Die öffentlichen Träger, die aus den einzelnen Sozialgesetzen zur Leistung verpflichtet sind, tragen die Gesamtverantwortung für ein nach Quantität und Qualität ausreichendes Angebot an Leistungen, um den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Auch die Planungsverantwortung ist davon umfasst (§§ 1 Abs. 2, 17 Abs. 1 SGB I und für den Bereich der Jugendhilfe §§ 79, 80 SGB VIII).
Erbracht werden kann die Leistung allerdings sowohl von öffentlichen als auch von privaten Trägern. Das öffentliche Fördersystem muss dabei die Pluralität der Träger und der Inhalte, Methoden und Arbeitsformen ermöglichen, unterstützen und gewährleisten (BVerwG v. 21.1.2010 – 5 CN 1.2009). Nur wenn verschiedenartige Leistungsangebote vorhanden sind, kann das Wunsch- und Wahlrecht der Berechtigten auch realisiert werden (allgemein: § 33 Satz 2 SGB I; Regelungen in den einzelnen Sozialgesetzen: § 2 Abs. 3 SGB V, § 5 SGB VIII, §§ 8, 104 Abs. 2 SGB IX, § 2 Abs. 2 SGB XI, § 9 SGB XII).
Читать дальше