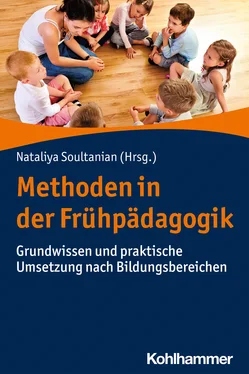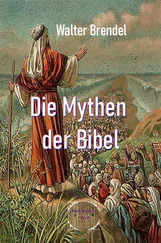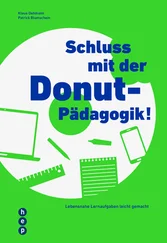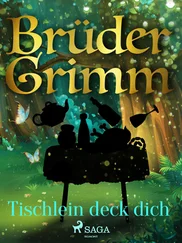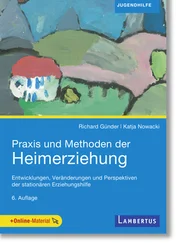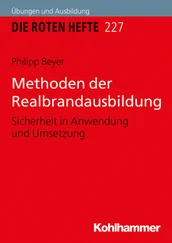Gefühlsausdrücke werden auf besondere Weise kommentiert, ob verbal oder im Fürsorge- oder Ablehnungsverhalten. Auf Hunger, Durst, Wärmebedürfnis, Schutzbedürfnis wird auf je besondere Weise eingegangen, auch die gesamte Palette der Bedürfnisse und deren Ausdruck werden mit oben beschriebenem Raster beurteilt. Manche Bedürfnisse sind zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten unangemessen, ihre Äußerungen unerwünscht oder sogar verboten. Ebenso werden Verhaltensweisen und Handlungen insgesamt zum Gegenstand der Beobachtung, Kommentierung und Bewertung durch Andere gemacht. Welche Gegenstände darf man anfassen, welche nicht, in welchen Räumen muss man sich wie benehmen (in der Kirche leise sein beispielsweise), welche Dinge muss man wie behandeln (mit Vorsicht oder mit Kraft), welche Handlungen werden wie mit welchen Gegenständen ausgeführt (in der Wohnung wird nicht Ball gespielt, der Tennisschläger ist keine Bratpfanne, das Bett ist kein Trampolin usw.). Der Mensch ist die einzige Spezies, welche die Biologie und Psychologie ihrer Nachkommen in einem normativen sozialen Raum vergegenständlicht und auf diese Weise normativ skulpturiert (Scruton, 2017). Eine der größten Entwicklungsherausforderungen für das Kind besteht also darin, sich in dieser normativen Lebenswelt aus Lob und Tadel, aus Anerkennung und Ablehnung, aus Zuspruch und Schelte zurechtzufinden und sich dauerhaft in einer solchen Bewertungsdynamik zu behaupten. Dabei muss das Kind lernen, auf die Dinge der Umgebung auf die richtige Weise zu reagieren und zugleich auch mit sich selbst auf die richtige Weise umzugehen. Das heißt aber, was es tut und was es bleiben lässt, und wie es sich zur Umgebung und zu sich selbst verhält, ist im Laufe der Entwicklungsbewältigung immer weniger unmittelbar impuls- und bedürfnisgetrieben, sondern vermittelt durch die Bewertung der Anderen. Das Kind entwickelt so einen inneren Abstand zu seinen Bedürfnissen, Regungen und Impulsen und lernt, sie mit den normativen Kriterien der Anderen einzuschätzen, sich zu kontrollieren und sich so in die bestehende Interaktionsordnung einzufügen.
Die »Anderen« übernehmen in diesem andauernden Prozess die Kontrolle »im Inneren« des Kindes. Dies ist eines der Fundamente für die Entwicklung eines personalen Selbst. Auf dieser Grundlage entsteht auch ein immer komplexer werdendes Selbstkonzept, in dem die verschiedenen Dimensionen der Selbstbeziehung, wie Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, Selbstwertgefühle, Selbstachtung und Selbstkontrollansprüche, integriert werden müssen. Ab einem bestimmten Alter wird auch die vorab bestehende Unmittelbarkeit der Selbstbeziehung, ein auf Bedürfnisbefriedigung und Spielvergnügen angelegtes, unmittelbares Selbstverhältnis durch den »Blick« der Anderen vermittelt. Nun ist jeder Blick in den Spiegel auch ein Blick der Anderen, wie sie mich sehen und beurteilen. Ich gefalle mir nur, sofern ich anderen gefalle, ich sehe und beurteile mich nach den Wahrnehmungs-, Konventions- und Moralkriterien der Anderen. Dabei entfaltet sich auch eine Grundmotivation menschlichen Lebens, nämlich das permanente Streben nach Anerkennung (Joas & Hübner, 2016). Ein Wesen, dessen Innerstes und scheinbar Eigenstes in sozialer Interaktion aufgebaut wird und dessen überlebenswichtige Selbstachtung von der Zuwendung Anderer abhängt, lebt notwendig ein soziales Leben, und stirbt einen sozialen Tod, wenn ihm die lebenswichtige Achtung und Anerkennung versagt bleibt. Auch wenn diese Entwicklungen weit über das Vorschulalter hinausgehen, werden doch in den ersten sechs Lebensjahren entscheidende Grundlagen gelegt.
2.4 Literatur (Kapitel 1 und 2)
Bamler, V., Schönberger, I. & Wustmann, C. (2010): Lehrbuch Elementarpädagogik. Theorien, Methoden und Arbeitsfelder. Weinheim, München: Juventa.
Becker, R. & Tremel, P. (2007): Auswirkungen vorschulischer Kinderbetreuung auf die Bildungschancen von Migrantenkindern. In: Soziale Welt, Heft 57, 397–418.
Becker, R. & Lauterbach, W. (2008): Vom Nutzen vorschulischer Erziehung und Elementarbildung – Bessere Bildungschancen für Arbeiterkinder? In: R. Becker & W. Lauterbach (Hrsg.), Bildung als Privileg. Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der Bildungsungleichheit (S. 129–159). Wiesbaden: Springer.
Berth, F., Diller, A., Nürnberg, C. & Rauschenbach, Th. (Hrsg.) (2013): Gleich und doch nicht gleich. Der Deutsche Qualifikationsrahmen und seine Auswirkungen auf frühpädagogische Ausbildungen. DJI-Verlag
Bogdan, R. (2012): Self-Consciousness: Executive Design, Sociocultural Grounds. ( https://consciousnessonline.wordpress.com/2012/02/17/self-consciousness-executive-design-sociocultural-grounds/), Zugriff am 17.07.2020.
Bründel, H. & Hurrelmann, K. (2017): Kindheit heute. Lebenswelten der jungen Generation. Weinheim, Basel: Beltz.
Brown, R. (Hrsg.) (2014): Consciousness Inside and Out: Phenomenology, Neuroscience, and the Nature of Experience. Niederlande: Springer.
Dreier, A. (2017): Nichts ist im Verstand, was nicht zuvor in den Sinnen war: Zur Bedeutung der ästhetischen Bildung in der Kindheit. In: H. Ballusek von (Hrsg.), Professionalisierung der Frühpädagogik (S. 197–211). Berlin, Toronto: Opladen.
Ekman, P. (2016): Gefühle lesen. Berlin: Springer Verlag.
Fröhlich-Gildhoff, K., Weltzien, D., Kirstein, N., Pietsch, S. & Rauh, K. (2015): Expertise zu Kompetenzen früh-/kindheitspädagogischer Fachkräfte, erstellt im Kontext der AG »Fachkräftegewinnung für die Kindertagesbetreuung« in Koordination des BMFSFJ.
Fthenakis, W.E. (2009). Ko-Konstruktion: Lernen durch Zusammenarbeit. In: Kinderzeit, 3, 8–13.
Gehlen, A. (1950): Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Bonn: Athenaum.
Gibson, E. & Pick, A. (2003): An Ecological Approach to Perceptual Learning and Development. New York: Oxford University Press Inc.
Gintis, H. et al. (2014): Observations on Zoon Politikon ( http://www.umass.edu/preferen/gintis/replytocommentators.pdf), Zugriff am 30.09.2020.
Havighurst, R. (1953): Human Development and Education. New York: David McKay & Co.
Hurrelmann, K. & Bauer, U. (2015): Einführung in die Sozialisationstheorie. (11. Auflage). Weinheim: Beltz.
Jares, L. (2015): Familienbildung als familienübergreifendes Bildungsangebot ( https://kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/elternarbeit/familienzentren/2332. Zu), Zugriff am 16.01.2020.
Joas, H. & Hübner, D. (Hrsg.) (2016): The Timeliness of Georg Herbert. Mead. Chicago: The University of Chigaco Press.
Lee, N. et al. (2009): The Interaction Instinct. The Evolutionl and Acquisition of Language. New York: Oxford University Press.
Lieberman, D. (2013): The Story of the Human Body. New York: Penguin UK.
Martin, A. (2007): The Representation of Object Concepts in the Brain. In: Annual Review of Psychology, Vol 5. 25–45.
Pramling Samuelsson, I., Asplund Carlsson, M. (2007): Spielend lernen. Stärkung lernmethodischer Kompetenzen. Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
Rauschenbach, Th. & Schilling, M. (2013): Ökonomische, rechtliche und fachpolitische Rahmenbedingungen der Kindertagesbetreuung. In: L. Fried & S. Roux (Hrsg.), Handbuch Pädagogik der frühen Kindheit (S. 44–55). Berlin: Cornelsen.
Reddy, V. (2008): How Infants know Minds. Cambridge: Harvard University Press.
Schäfer, G. (2011): Bildungsprozesse im Kindesalter. Selbstbildung, Erfahrung und Lernen in der frühen Kindheit (4. Auflage). Weinheim, München: Juventa.
Scruton, R. (2017): On Human Nature. New York: Princeton University Press.
Seemann, A. & Racine, T. (2012) (Hg.): Joint Attention. New Developments in Psychology, Philosophy, and Social Neuroscience. London: The MIT Press.
Stern, D. (1985): The Interpersonal World of the Infant. New York: Perseus Books UK.
Tietze, W., Roßbach, H.-G. & Grenner, K. (Hrsg.) (2005): Kinder von 4 bis 8 Jahren. Zur Qualität der Erziehung und Bildung in Kindergarten, Grundschule und Familie. Weinheim: Beltz.
Читать дальше