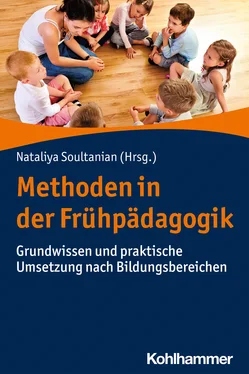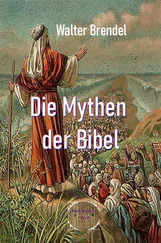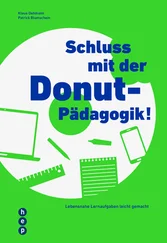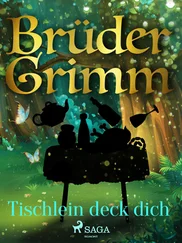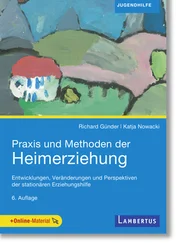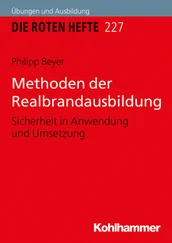Mit Blick auf die einflussreichen anthropologischen Analysen Arnold Gehlens kann man sagen, dass Menschen entspezialisierte Alleskönner im Bereich der Körperbewegung und Körperbeherrschung sind, im Gegensatz zu Tieren, die auf einen Bewegungsbereich spezialisiert und darin wahre Meister sind, aber ansonsten eher ein klägliches Bild abgeben (Gehlen, 1950). Selbst den mit Menschen aufgewachsenen Schimpansen oder anderen Primaten ist es nicht möglich, tanzen oder rhythmische Bewegungen zu erlernen, selbst bei intensivem Training erreichen sie keinen feinmotorischen Umgang mit Dingen, können kaum tragen, differenziert greifen usw. Menschen können nicht so schnell sprinten wie Geparde, aber mit Übung bringen sie auch darin Beachtliches zustande. Außerdem können sie über lange Zeit und Distanzen laufen, was evolutionär sicherlich als Adaptionskomplex in Wechselwirkung mit dem Verlust des Fells und der Ausbildung von Schweißdrüsen einherging, was der Fähigkeit zum Dauerlaufen eine physiologische Grundlage gab (Lieberman, 2013). Die alle weiteren menschlichen Entwicklungsaufgaben fundierende Kompetenzentwicklung besteht also in dem, was man näherungsweise das »motorische Erlernen der Welt und die Kontrolle eines Körperselbstes« nennen könnte (Stern, 1985).
Die Fähigkeit zum stabilen aufrechten Stehen und zum aufrechten Gang ist genetisch vorbestimmt, sie bedürfen keiner besonderen externen Motivation oder externer Instruktionen, sie initiieren und entwickeln sich unter normalen Bedingungen von selbst. Aber die gegenstandsbezogenen Umweltbewegungen müssen erlernt werden. Diese Entwicklungsaufgabe besteht in einer sehr weit gefächerten motorischen Aneignung der materiellen Umwelt, der menschliche Organismus verinnerlicht aktiv die Umweltgegebenheiten. Man muss sich nur einmal vergegenwärtigen, welcher Entwicklungs- und Lernaufwand hinter der Fähigkeit steht, eine Tasse oder einen gefüllten Becher zu ergreifen, zum Mund zu führen und wieder auf einen Tisch zu stellen (ohne dass das Behältnis zerbricht), oder einen Ball zu werfen und zu fangen oder einen Stift richtig zu fassen und kontinuierlich über ein Blatt Papier zu führen (Gehlen, 1950). Wenn man nun in Betracht zieht, wie komplex unsere artifiziellen Lebensumwelten sind, wird umso deutlicher, welche Leistungen hier von Kindern in ihrer vorschulischen Entwicklung erbracht werden müssen. Allgemein lässt sich diese Aufgabe wie folgt beschreiben: Kinder müssen die vielfältige »Aufforderungsstruktur« der Dinge körperlich-motorisch verinnerlichen (Gibson, 1950). 3 Dinge sprechen und Kinder müssen verstehen lernen. Gebrauchsdinge und Naturdinge gleichermaßen fordern zu einem jeweils motorisch differenzierten Umgang mit ihnen auf. Ein Stuhl sagt: »Ich bin ein Stuhl, komm, sitz auf mir!« Ein Becher fordert, »Wenn du Durst hast, fülle mich und trink aus mir! Wenn du Spiellust hast, fülle mich mit Matsch«. Das Messer sagt (nach einigen expliziten Erziehungsprozessen): »Nimm mich in die rechte Hand, schneide mit mir, aber wehe, du steckst mich in den Mund!« Der Teppich fordert auf zum Wälzen, Kuscheln, Sitzen, Liegen. Wasser, Sand, Matsch, Zäune, Blumen fordern die ihnen je eigene attraktive Handlung, die Gartenmauer fordert vehement: »Klettere auf mich, balanciere auf mir, spring von mir.« Der Ball sagt: »Kicke mich, nimm und wirf mich«, die Buntstifte sagen: »Nimm mich und kritzele alles voll«. Die Pfützen fordern nachdrücklich: »Spring rein in mich und patsche in mir rum!« Dem Aufforderungscharakter der Dinge, den sozial strukturierten Räumen und der ebenso strukturierten Situationen entsprechen Typen von eingeübten Bewegungen und motorischen Fertigkeiten. Die erschlossenen, teils hergestellten, teils natürlichen, aber immer strukturierten und geordneten Lebensumgebungen, in denen Kinder heranwachsen, sind selbst konstitutive Bestandteile der geistigen Entwicklung, sie stellen ein komplexes Scaffolding menschlicher Wahrnehmung und Kognition dar (Gibson, 1950).
2.2 Kommunikation und Interaktion: Soziale Entwicklungsaufgaben
Menschliche Bewegungsfähigkeiten unterliegen auch der Entwicklung sozialer Kompetenzen und dem Hineinwachsen in familiale Lebensgemeinschaften. Der aufrechte menschliche Körper und dessen unbegrenztes Bewegungsrepertoire bilden nicht nur die Voraussetzung für den vielfältigen praktischen oder spielerischen Gebrauch von Dingen, sondern sind auch Grundlage menschlichen Ausdrucks-, Interaktions- und Kommunikationsverhaltens. Bei näherer Betrachtung scheinen der menschliche Körper und seine motorischen Fähigkeiten geradezu als »Kommunikationsmedium« evolviert zu sein (Reddy, 2008). Die freien und fein beweglichen Hände dienen ebenso zur Kommunikation wie zum Tragen, Halten, Werfen oder Arbeiten, verschiedene Körperhaltungen und gestische Bewegungen und ein unbehaart-offenes, sehr bewegliches Gesicht (es gibt mehr als 50 verschiedene Gesichtsmuskeln, Ekman, 2016) begründen körperlich die einzigartige Fähigkeit menschlicher Intersubjektivität. Diese bildet auch die Voraussetzung für den Erwerb der Sprachfähigkeit (Tomasello, 2019).
Der menschliche Organismus ist körperliches Emotions- und Kommunikationsdisplay. Das Gesicht und der gesamte Körper sind höchst berührungssensitiv. Berührung durch Andere ist Ursprung und Ausgangspunkt aller non-verbaler Interaktion und unterliegt aller frühkindlichen Etablierung primärer Intersubjektivität. Zur Rolle der Gesichts- und Körperbewegungen in der ursprünglichen Interaktion zwischen Mutter und Kind ist auf die berühmten »still-face-Experimente« zu verweisen. Die Experimente veranschaulichen sehr gut, was die neuere Forschung »primäre Intersubjektivität« (Trevarthen, 2007) nennt. Hier findet man alles, was die Einzigartigkeit menschlicher Interaktion und die Fähigkeit zu einer »gemeinsam geteilten Psyche« ausmacht: Gesicht, Körpersprache, Zeigegesten, gemeinsame Aufmerksamkeit, gemeinsam geteilte Intentionalität, Einschwingen und Synchronie von Bewegungen und dadurch von inneren Zuständen. Auf dieser Basis entstehen die frühkindlichen Interaktionsrituale und das Einschwingen psychischer Zustände, die Dynamik positiver emotionaler Energie und ein tiefes Vergnügen der Beteiligten, oder umgekehrt, tiefe Verunsicherung, Entsetzen und Panik, bei ausbleibendem Interaktionsfeedback (vgl. auch Collins, 2005). 4
Es gibt keine natürliche spontane sprachliche Äußerung, die nicht von Körperhaltungen, Gesichtsausdrücken und vor allem von Arm- und Handgestik begleitet wäre. Das Gesicht mit vielen Gesichtsmuskeln sorgt für eine hochdifferenzierte mimische Ausdrucksfähigkeit. Die Augen sind groß, offen und ermöglichen, wie sonst nirgends in der Natur, mit Blicken zu kommunizieren, die Blicke der Anderen wahrzunehmen, die Blickrichtung zu erkennen und ihr gegebenenfalls mit dem eigenen Blick zu folgen. Es ermöglicht den Blick »in die Seele« des Anderen, in seine Stimmungslagen, ja sogar in seine Aufrichtigkeit oder seine Täuschungsabsichten. Nicht zufällig sind soziale Emotionen wie Scham an bestimmte Kopfhaltung mit dem Senken des Blickes verbunden.
Blicken folgen zu können ist wesentlicher Bestandteil einer weiteren Besonderheit menschlicher Sozialkompetenzen, nämlich der Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu teilen bzw. sie gemeinsam auf einen Gegenstand zu richten (Tomasello, 2019). Die gesamte Körperhaltung, die Blickrichtung und die Art des Blickes (ob beispielsweise Neugier, Interesse, Langeweile, Freude oder Panik im Blick transportiert werden) und Zeigegesten sind allesamt Mittel der gemeinsamen Aufmerksamkeitserzeugung und -steuerung. Zugleich vermitteln besonders der Blick und der Gesichtsausdruck elementare affektive Bewertungen dessen, worauf die Aufmerksamkeit sich richten soll.
Menschliche Emotionen sind eben nicht primär gefühlte Bestandteile einer subjektiven »Innenwelt«, sondern bilden vor allem die Basis menschlicher Kommunikation. Gefühle im eigenen Gesicht ganz automatisch auszudrücken und in den Gesichtern Anderer »lesen« zu können, meist nicht ausdrücklich und bewusst, trägt die gesamte menschliche Intersubjektivität in der frühkindlichen Entwicklung, genauso wie alle späteren Formen menschlicher Vergemeinschaftung. Lachen ist ansteckend und hebt die Stimmung aller Beteiligten, neugierige Blicke zum Himmel verleiten die Umstehenden, ebenfalls nach oben zu schauen und eine neugierige Erwartungshaltung einzunehmen, der Ausdruck von Kummer und Leid verursacht tiefes Mitgefühl, Tränen bei den Anderen motivieren schon sehr kleine Kinder, tröstend beizustehen (Ekman, 2016).
Читать дальше