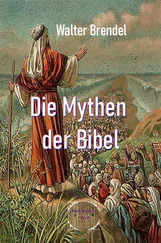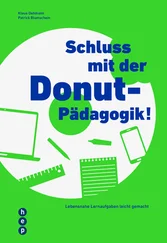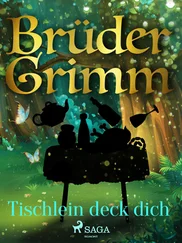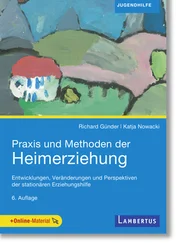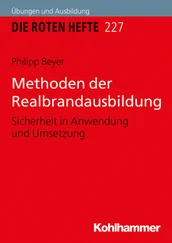Elementar meint im Zusammenhang dieser Perspektive einerseits die grundlegende Bedeutung der Ebene der Sinnlichkeit (aisthesis) für Bildungsprozesse. Andererseit wird damit auch auf die grundlegende leibliche Struktur des zur-Welt-Seins verwiesen. Zur-Welt-Sein bedeutet in diesem Kontext das Wechselspiel aus dem sinnlichen Antworten auf Welt, in der sich einlassenden Berührung der Wahrnehmung, und dem Antworten auf diesen Eindruck, in einer gestalterischen Handlung, als Ausdruck hin zur Welt, der wiederum beantwortet werden möchte.
Ästhetisch greift die strukturelle Ebene des leiblichen Zur-Welt-Seins auf, die im leiblichen Wechselspiel von Eindruck und Ausdruck als ästhetisch-gestalterische Ebene von Bildung schon angelegt ist. Sie kommt jedoch erst im Ereignis der ästhetischen Erfahrung voll zum Tragen. Denn die ästhetische Erfahrung ist eine besondere Art und Weise des Berührtseins. Dieses besonders intensive Eindrucksgeschehen, das darüber die funktional-alltägliche Ebene sinnlicher Wahrnehmung verlässt, ist ein Impuls, auf vielfältigste Arten und Weisen im Interesse, im Dazwischensein ein Phänomenfeld im gestalterischen Handeln ausdifferenzierend wahrzunehmen, was in Folge zur Bildung eines reichen Selbst- und Weltverständnisses führt. Beim Aspekt des Ästhetischen im Kontext dieser Bildungsperspektive geht es also um die Bedeutung gestalterischen Handelns als Symbolisierungsgeschehen und in Verbindung damit um die Frage, welche Phänomene überhaupt thematisch werden können und welche Handlungs- und Wahrnehmungsweisen zur Verfügung stehen.
Die Dimension des Ästhetischen ist dabei insbesondere bei Kindern von so großer Relevanz, da sie noch ganz leicht in eine staunend-ästhetische Wahrnehmung von sinnlichen Gegebenheiten kommen, da sie ja noch viel stärker dabei sind, die Welt und sich selbst kennenzulernen (Dunker, 2010). Dadurch ist die sinnliche Wahrnehmung bei Kindern noch weniger durch Vorstellungen, geklärte Wahrnehmungsgestalten und eine funktionale Perspektive überformt und sie geraten leichter in einen Modus ästhetischer Erfahrung.
3.2 Relevanz von Erfahrungsräumen jenseits geklärter Normen
»Neulich war ich in einer Kita zur Hospitation. Dort wurde ich auf eine Gruppe von 4 bis 5-jährigen Kindern aufmerksam, die um ein Waschbecken standen. Ich ging näher zu der Gruppe hin und sah, dass sich die Kinder mit dem Phänomen eines anscheinend defekten (weil tropfenden) Wasserhahns auf verschiedene Arten und Weisen auseinandersetzten.« 5
Nach der im letzten Abschnitt erfolgten ersten theoretischen Einführung in eine elementar-ästhetische Bildungsperspektive wird anhand dieser beobachteten Alltagssituation aus einer Kita, auf die im Folgenden immer wieder verwiesen wird, die ästhetische Perspektive auf Bildung weiter entfaltet. Dadurch soll vor allem auch ihre pädagogische handlungs- und bildungspraktische Relevanz verdeutlicht werden.
Interessant an dem Beispiel des tropfenden Wasserhahns ist, dass sich das Interesse der Kinder aus einer alltagsfunktionalen Erwachsenenperspektive an einem Defekt entzündet. Denn wäre der Wasserhahn nicht defekt, würde er nicht tropfen. Anhand dieses Tatbestandes des »Defektes« wird die Relevanz des Anderen entwickelt, und zwar in seiner doppelten zusammenhängenden Bedeutung. Einerseits das Da-Sein einer sinnlichen Gegebenheit, eines dinglich Anderen, in dem konkreten Fall unseres Beispiels des »defekten« Wasserhahns, der das Auftreten eines funktional nicht determinierten Phänomens überhaupt erst ermöglicht. Andererseits die Bedeutung der Anderen, der Pädagog*innen, die mitentscheidend ist für das Vorhandensein der sinnlichen Gegebenheit, der Möglichkeit, mit dieser eine ästhetische Erfahrung zu machen und vor allem für den weiteren handelnden Umgang mit dem Phänomen, der zu seiner Entfaltung und Ausdifferenzierung führt.
3.2.1 Die Relevanz der Anderen
Kindertagesstätten sind wie alle pädagogischen Institutionen durch und durch kulturell geprägte Räume, das heißt nichts an und in ihnen ist natürlich oder naturgegeben. Daraus folgt, dass ihre gesamte Beschaffenheit in all ihren Aspekten (z. B. Raum, Ausstattung, Materialien) und wie mit diesen umgegangen wird (Zeit, Interaktion/Handlungsweisen, Tagesstruktur) normativ geprägt ist. Diese Normen bestimmen als in unseren Leib eingeschriebene Muster oder auch habits der Wahrnehmung und des Ausdrucks, wie wir uns selbst und die Welt wahrnehmen (wollen/sollen) und wie wir uns zur Welt hin ausdrücken (wollen/sollen) (Dewey, 2000). Und genau diese normativen Muster, das Wie unserer Wahrnehmung von Welt und unseres Selbst und des Wie unseres Ausdrucks zur Welt lassen sich auf einer strukturanalytischen Ebene als Kultur verstehen (Cassirer, 2007). Dies umso mehr, da gerade auch unsere habits Objekte und Dinge hervorbringen, die Kultur in diesem Sinne bestätigend sichern als auch ermöglichen (Nießeler, 2012).
Vor dem Hintergrund dieses Verständnisses des Zusammenhangs von Objekten, Normen und Kultur ist das Beispiel des tropfenden Wasserhahns sehr interessant. Der tropfende Wasserhahn entspricht nicht der Norm, er ist aus einer alltagsfunktionalen Perspektive defekt, sonst würde er nicht tropfen. Dieser Zusammenhang verweist auf die Bedeutung von sinnlichen Gegebenheiten für Bildungsprozesse, die noch nicht normativ-restriktiv, beziehungsweise funktional definiert sind. Denn gerade anhand dieser offenen, vielschichtigen, nicht reglementierten, sinnlichen Gegebenheiten entzünden sich Ästhetische Erfahrungen viel leichter. Durch diese dadurch entstehende phänomenale Wahrnehmung, verstanden als Wahrnehmungsereignis, entsteht ein offenes und diverses Wahrnehmungsfeld, das umso vielfältiger und intensiver ist, je weniger es normativ oder funktional beschränkt wird. Würde eine Pädagogin auf die Kinder am Wasserhahn aufmerksam werden und den Kindern verbal oder und nonverbal vermitteln: »Ach wie blöd, der Wasserhahn ist ja kaputt, ich muss dringend dafür sorgen, dass er repariert wird«, würde das Phänomen des Tropfens, von dem die Kinder ergriffen sind, sofort disqualifiziert und funktional, aufgrund seiner aus einer Alltagslogik bestehenden Dysfunktion, eingeordnet und damit zerstört. Dadurch würde einerseits das Interesse der Kinder an dem Eigensinn und damit dem Eigenwert des Phänomens des tropfenden Wasserhahns nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen, und anderseits kann in Folge dann die Pädagog*in die Begegnung und Auseinandersetzung mit dem Phänomen als ein mögliches erweitertes Bildungsfeld nicht ermutigen oder unterstützen.
Das heißt die Anderen sind dafür entscheidend:
 Welche sinnlichen Gegebenheiten überhaupt vorhanden sind, in die Kita aktiv aufgenommen, geduldet, ja welche Kultur sinnlicher Gegebenheiten intendiert ist.
Welche sinnlichen Gegebenheiten überhaupt vorhanden sind, in die Kita aktiv aufgenommen, geduldet, ja welche Kultur sinnlicher Gegebenheiten intendiert ist.
 Welche grundlegenden Bedingungen (Umgang mit Zeit, Arrangements und Darbietung von Gegenständen und Materialien) geschaffen werden, damit sinnliche Gegebenheiten ihr Potential für Ästhetische Erfahrungen entfalten können.
Welche grundlegenden Bedingungen (Umgang mit Zeit, Arrangements und Darbietung von Gegenständen und Materialien) geschaffen werden, damit sinnliche Gegebenheiten ihr Potential für Ästhetische Erfahrungen entfalten können.
 Welche Wahrnehmungs- und Handlungsformen geduldet, unterstützt oder auch angeregt werden, damit, ausgehend von einer ästhetischen Erfahrung, ein Phänomenfeld, das sich mit dieser eröffnet, gestaltend-erfahrend erkundet und dadurch in seiner Differenziertheit wahrgenommen werden kann.
Welche Wahrnehmungs- und Handlungsformen geduldet, unterstützt oder auch angeregt werden, damit, ausgehend von einer ästhetischen Erfahrung, ein Phänomenfeld, das sich mit dieser eröffnet, gestaltend-erfahrend erkundet und dadurch in seiner Differenziertheit wahrgenommen werden kann.
Ein anderes Beispiel soll die Bedeutung der Anderen, die Relevanz der Pädagog*innen für den Umgang mit sinnlichen Gegebenheiten weiter verdeutlichen. Eine Kita hat in ihrem Außenbereich eine geteerte Fläche, in deren Mitte sich ein Abfluss befindet. Da der Abfluss verstopft ist und nur wenig Wasser passieren lässt, bildet sich bei stärkeren Regenfällen regelmäßig eine richtig große Pfütze, mit der manche Kinder begeistert immer wieder auf ganz unterschiedliche Art und Weise spielen. Manche Kinder müssen jedoch aber auch geradewegs ermutigt werden, mit dem Wasser zu spielen. Es wirkt so, dass manche von den Älteren schon den habit einverleibt haben: Mach Dich nicht schmutzig oder nass!
Читать дальше
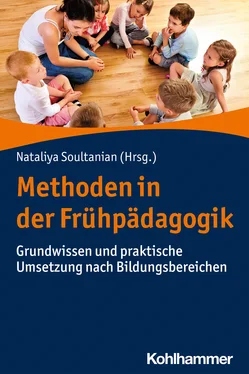
 Welche sinnlichen Gegebenheiten überhaupt vorhanden sind, in die Kita aktiv aufgenommen, geduldet, ja welche Kultur sinnlicher Gegebenheiten intendiert ist.
Welche sinnlichen Gegebenheiten überhaupt vorhanden sind, in die Kita aktiv aufgenommen, geduldet, ja welche Kultur sinnlicher Gegebenheiten intendiert ist.