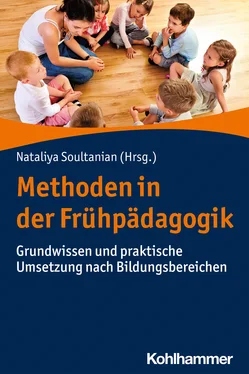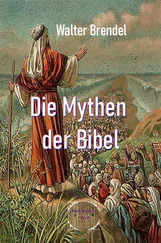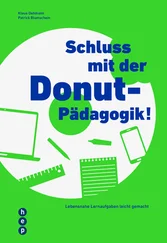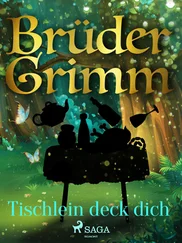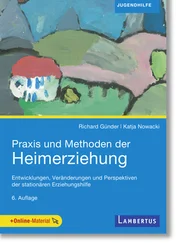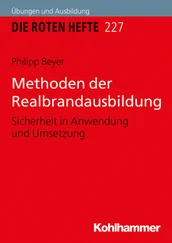An dieser Stelle wird auf zwei ganz grundlegende Medien der spielerischen Exploration eingegangen, die, weil sie so elementar sind, oft aus dem Blick geraten und damit oft den blinden Fleck der Reflexion bilden. Anhand dieser lässt sich deshalb die Relevanz einer professionellen Haltung aus einer ästhetisch-bildungstheoretischen Perspektive besonders gut verdeutlichen: Zeit und Raum. Raum und Zeit sind zwei Grundvoraussetzungen für ästhetische Bildungsprozesse, die ja stets mit dem Berührt-Sein von und durch Etwas beginnen, einem intensiven Eindruck, einem Anderen, das auf einen wirkt, einer ästhetischen Erfahrung. Damit dieser Eindruck seine Wirkung entfalten kann, braucht es Zeit. Es braucht Zeit, damit der sinnliche Eindruck als ästhetische Erfahrung seine Wirkung entfalten kann, als ein Einwirken. Genauso braucht dann auch das explorativ-spielerische Handeln Zeit, mit dem auf das Einwirkungsgeschehen durch eigensinniges Handeln als gestalterischer Ausdruck geantwortet werden kann. Der Raum ist dabei als Medium neben dem Faktor Zeit entscheidend dafür, welche Eindrücke überhaupt entstehen können. Denn der Raum entscheidet, welche Spielformen, verstanden als eine gestalterische, expressiv-wahrnehmende Handlung, sich überhaupt entwickeln können. So kann zum Beispiel durch eine üppige Möblierung von Räumen, wie sie in Kitas durchaus oder oft noch üblich ist, der Raum als Erfahrungsraum verloren gehen. Er wirkt oder dient dann eher im Sinne einer Kontrolle von Wahrnehmungs-, Handlungs- und Bewegungsimpulsen und steht dadurch nicht mehr als Medium der Wahrnehmung und Handlung, zum Spiel und der Gestaltung zur Verfügung.
Demgegenüber geht es aus einer ästhetischen Perspektive auf Bildung um die Realisierung räumlich-materieller Dispositionen, die vielfältige Wahrnehmungs- und Handlungsweisen ermöglichen und selbst auch das Medium Raum als Raum erfahrbar werden lassen. Gleichzeitig verweist die ästhetisch-bildungstheoretische Reflexion der beiden Aspekte Raum und Zeit darauf, dass auch das sogenannte vermeintliche Freispiel ein bedingtes Spiel ist. Denn neben der Bedeutung der normativen Aspekte, die in dem Da-Sein des Anderen und der Anderen stecken, wie in den letzten beiden Abschnitten ausgeführt wurde, ist das Freispiel auch davon abhängig, in welchen Zeit-Räumen es sich entwickeln und entfalten kann und darf. Insofern sind auch diese beiden ganz grundlegenden Bildungsmedien Raum und Zeit, und das mag an dieser Stelle nicht mehr überraschen, wiederum von der professionellen Haltung abhängig: Werden sie kontinuierlich reflektiert und wenn nach welchen Kriterien und Normen gestaltet?
Grenzen und Verbote: Ein kleiner Exkurs zu einer ethisch-ästhetischen Perspektive
Im Zusammenhang mit den hier ausgeführten Gedanken zu einer reflexiven professionellen Haltung wird noch auf einen Punkt eingegangen, der vielleicht die ein oder andere Leser*in beim Lesen der letzten beiden Abschnitte schon beschäftigt hat: Gibt es auch Grenzen oder auch Verbote? Selbstverständlich führt eine ästhetisch-bildungstheoretische Perspektive die Frage von Grenzen und auch von Verboten als kontinuierliches Thema mit sich, aber eben nicht im Sinne einer absoluten Moral, sondern als ein situativ-relational-ethisches. Da es bei einer ästhetischen Bildungsperspektive immer um die Frage des Berührtseins von etwas und das Handeln zu etwas geht, geht es damit immer auch implizit oder auch explizit um die Themen von Achtsamkeit und Respekt. Das heißt nicht, dass es nicht situativ genau auch um die Erfahrung von Grenzüberschreitungen geht oder gehen kann. Denn aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive scheint es doch vielmehr so zu sein, dass zum Kennenlernen und auch zum Lernen der Achtung von Grenzen diese manchmal auch situativ überschritten werden müssen. Insofern ist eine ethische Perspektive, also die Frage nach situativen Regeln, der kontinuierliche Begleiter einer ästhetischen Bildungsperspektive. Sie erfordert das situativ-relationale Setzen von Grenzen und auch Verboten, wenn die Achtsamkeit gegenüber dem Anderen oder gegenüber des Anderen ganz verloren zu gehen droht, oder auch die Grenzüberschreitung, um die es vielleicht gerade geht, gar nicht mehr wahrgenommen wird.
Abschließend und als Überleitung zum nächsten Kapitel, gerade auch vor dem Hintergrund des kurzen Exkurses zu Grenzen und Regeln, soll nochmals zusammenfassend auf die Frage eingegangen werden, warum es so wichtig ist, dass Kindern ein weites Feld an Wahrnehmungsmöglichkeiten und ästhetischen Erfahrungen ermöglicht wird. Damit verbunden ist die bildungstheoretische Notwendigkeit, für Grenz- und Regelsetzung im höchsten Maße professionelle Verantwortung zu übernehmen, indem kontinuierlich im Sinne einer professionellen Haltung individuell und im Team über diese, und dort, wo möglich, auch im Dialog mit den Kindern, reflektiert wird.
Eine elementar ästhetisch-bildungstheoretische Perspektive betont das Faktum der Wechselseitigkeit von Selbst- und Welterfahrung. Kinder erfahren sich selbst und die Welt in und über ihr spielerisch-exploratives Handeln. Mit und über diese Erfahrungen bilden sie sich ein Bild von sich und der Welt und zwar in zweifacher Hinsicht: Was ist Welt und was sind sie selbst und wer sind sie in dieser Welt und wie ist die Welt zu ihnen? Dadurch bilden sich nicht nur reiche, sinnesvolle, differenzierte, symbolische Begriffe und sprachlicher Ausdruck. In den ästhetisch-spielerischen Deutungsversuchen bilden sich auch hochrelevante Fähigkeiten: genaue Wahrnehmung und Beobachtung, Vertrauen in die eigenen Ideen, Respekt vor dem Anderen und im besten Fall die essentielle Erfahrung der Unterstützung, der Ermutigung und Inspiration von und durch Andere.
Der Aspekt der Ermutigung, Unterstützung und Inspiration von und durch Andere, als eine weitere und vielleicht anspruchsvollste Facette einer professionellen Haltung, führt auch zu einer weiteren wichtigen Einsicht einer elementar-ästhetischen Bildungsperspektive: dem bildungsbereichsübergreifenden Charakter von Phänomenen. Wie dieser in Wahrnehmung und Handlung konkret unterstützt und gefördert werden kann, darum geht es im nächsten Kapitel.
3.3 Eine bildungsbereichsübergreifende Perspektive
Es gibt keine bildungsbereichsspezifischen Phänomene, Phänomene sind immer bildungsbereichsübergreifend. Sie sind ein offenes und weites Wahrnehmungsereignis, das sich nicht einem bestimmten Bildungsbereich zuordnen lässt (Duncker, 2010). Insofern sind sie immer inklusiv und lassen sich von vornherein nicht exklusiv einem Bildungsbereich zuordnen, sie berühren mehr oder weniger potentiell immer alle Bildungsbereiche (Wagenschein, 1980). Dies liegt an der jeweils unterschiedlichen individuellen Akzentuierung in der ästhetischen Erfahrung eines Kindes, die ihm jeweils einen eigenen Zugang zu einem Phänomen eröffnet. Gerade aufgrund der mannigfaltigen Möglichkeiten in der jeweiligen Akzentuierung im Berührtsein durch ein Phänomen macht es Sinn, vom Feld eines Phänomens oder eben Phänomenfeld zu sprechen. Jedoch lassen sich im Anschluss daran, gerade um einen orientierenden Rahmen für die Arbeit mit einer Gruppe von Kindern zu haben, aber auch zu bieten, weitere Handlungen zu und mit dem Phänomenfeld anregen. Um dies zu verdeutlichen, wird erneut auf das schon bekannte Beispiel des tropfenden Wasserhahns eingegangen.
Für einen zunächst weiten bildungsbereichsübergreifenden als auch in Folge dann bildungsbereichsdifferenzierend-anregenden Umgang mit einem Phänomen braucht es zunächst die Offenheit in der Wahrnehmung der Pädagog*innen. Es kommt darauf an, die Kinder in der Situation, in der sie sich befinden, in ihrem Interesse nicht nur wahrzunehmen, sondern dieses in seinem Potential wertzuschätzen. Dafür ist es zunächst wichtig, dass die Pädagog*innen die Kinder im und immer wieder in deren Staunen, im Berührtsein durch das Phänomen verweilen lassen. Die große Differenziertheit und auch Feinheit, die im spezifischen Zugang zu einem Phänomen von Kindern oder auch eines Kindes zum Ausdruck kommt, ist ein Plädoyer dafür, diese Mannigfaltigkeit zunächst vor allem wahrzunehmen und ihr Zeit und Raum zu geben in ihrem Zugang zu, im Umgang mit und in der Ausdifferenzierung des Phänomenfelds.
Читать дальше