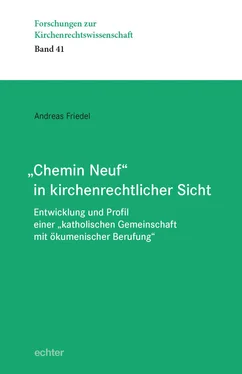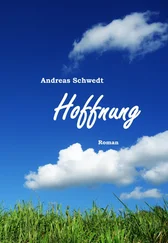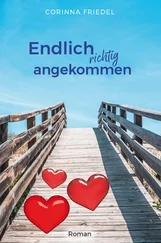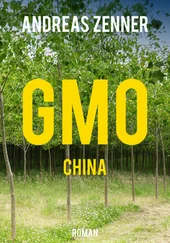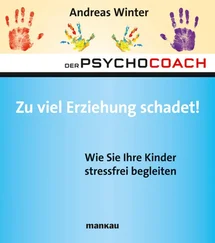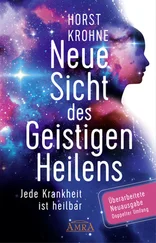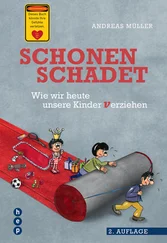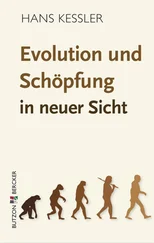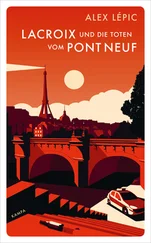Laurent Fabre hat auf dem 4. Generalkapitel der Kommunität, das im August 2016 in der ostfranzösischen Abtei Hautecombe tagte, im Alter von 75 Jahren sein Amt als oberster Leiter der Gemeinschaft abgegeben. Er stand der Gemeinschaft 43 Jahre vor. Zu seinem Nachfolger wurde François Michon (50) gewählt. Michon ist Priester des CCN-Klerikerinstituts. Er hat Sozialwissenschaften studiert und knapp zehn Jahre im Dienst der Kommunität in Afrika verbracht. 106Michon übernahm wie sein Vorgänger in Personalunion die Leitung des kirchlichen Vereins CCN und die Leitung des CCN-Klerikerinstituts. Auf dem Generalkapitel erreichte er bereits im ersten Wahlgang die nötige Stimmenmehrheit. 107
1.6 Die Niederlassungen in Deutschland
1.6.1 Chemin Neuf im Erzbistum Berlin
Die Gemeinschaft ist in Deutschland in Berlin und Bonn ansässig. Die Kommunität wurde, nach eigener Darstellung, im Jahr 1989 durch die in Berlin ansässigen Jesuiten eingeladen, eine Kana-Woche für Ehepaare zu organisieren. Aus diesen ersten Kontakten heraus erwuchsen Beziehungen zum Erzbistum Berlin, die 1992 zur Gründung einer Niederlassung der Gemeinschaft in der Pfarrei Maria-Magdalena in Berlin-Niederschönhausen führten. 108CCN wurde 1994 die katholische Pfarrgemeinde Herz-Jesu im Stadtteil Prenzlauer Berg anvertraut. 109In der Pfarrei St. Adalbert ist die Kommunität mit dem ökumenischen Zentrum „Net for God“ präsent. 110Diese Pfarrei gehört seit der Pfarrfusion 2003 zur Herz-Jesu-Pfarrei.
Im Jahr 2006 übernahm CCN das Kloster der Christkönigschwestern in Berlin-Lankwitz. Das Kloster diente als ein Begegnungs- und Fortbildungszentrum für Einzelpersonen und Gruppen. Die Christkönigschwestern zogen sich aus Altersgründen in den Ruhestand zurück. 111Die Gemeinschaft führt das Ordenshaus weiterhin als Exerzitien- und Begegnungsstätte. Der Berliner Zweig besteht zurzeit aus einer Lebens- und einer Stadtviertelfraternität. Den beiden Berliner Fraternitäten gehören etwa 25 Personen an. Drei Viertel der Mitglieder sind katholische Christen. 112
1.6.2 Übernahme der Hochschulseelsorge in Bonn
Der Kontakt zum Erzbistum Köln ergab sich 2005 beim Weltjugendtag, an dem sich die CCN-Jugend beteiligte. Joachim Kardinal Meisner fragte nach Angaben von CCN die Gemeinschaft an, ob sie bereit sei, die Hochschulseelsorge in Bonn zu übernehmen. Durch das Einbeziehen geistlicher Gemeinschaften in die Seelsorge, so erläutert eine Veröffentlichung des Erzbistums, erhoffte sich der damalige Kölner Erzbischof neue Impulse für die Seelsorge. 113Der Personalwechsel in der Bonner Hochschulgemeinde fand zu Beginn des Wintersemesters 2007/2008 statt. Kritik äußerten die Konferenz für Katholische Hochschulpastoral in Deutschland (KHP) und Mitglieder der Hochschulgemeinde. Sie befürchteten, die spirituelle Vielfalt sowie politisch-gesellschaftliche Debatten in der Hochschulgemeinde könnten verloren gehen. 114Die Hochschulseelsorge wurde der Gemeinschaft vorerst befristet auf fünf Jahre übertragen. 115Pater Hasso Beyer von CCN wurde mit Wirkung vom 15. August 2007 zum Hochschulpfarrer an der Katholischen Hochschulgemeinde der Universität Bonn und der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg ernannt. 116CCN zog in das Pfarrhaus der St. Remigius-Gemeinde ein, das sich auf dem Gelände der Hochschulgemeinde im Zentrum von Bonn befindet. Die Hausgemeinschaft besteht aus einer Schwester und einem Priester, zwei Singles und zwei Ehepaaren. Die beiden Ehepaare leben nicht im selben Haus. Trotzdem werden sie als Mitglieder der Hausgemeinschaft betrachtet. Von den acht Mitgliedern der Bonner Fraternität gehört eines der evangelisch-lutherischen Kirche und eines einer Baptistengemeinde an. 117
1.7 Die Ausbildung rechtlicher Strukturen
Alexandre-Charles Kardinal Renard von Lyon erkannte die Gemeinschaft 1981 als eine pia unio nach den Normen des CIC/1917 an. Unter einem frommen Verein verstand can. 707 § 1 CIC/1917 eine Vereinigung von Gläubigen zur Ausübung von Werken der Frömmigkeit und der Nächstenliebe. Der CIC/1917 kannte neben den piae uniones die Kategorien der Drittorden mit dem Zweck der inneren Vervollkommnung der Mitglieder und die Bruderschaften, bei denen das Augenmerk auf der Förderung des öffentlichen Kultes lag. 118Die Zuordnung zur Kategorie der piae uniones war für die Verantwortlichen der CCN und der Diözese das Naheliegende. Nach der Einführung des neuen kirchlichen Gesetzbuches von 1983 wurde CCN von Kardinal Decourtray am 20. April 1984 als öffentlicher Verein von Gläubigen approbiert. 119Der Päpstliche Rat für die Laien 120(PCL) listet CCN in seinem 2006 veröffentlichten Direktorium entsprechend. 121Die Konstitutionen des Vereins sind in Zusammenarbeit mit dem Kirchenrechtler Michel Dortel-Claudot erstellt worden. 122Laurent Fabre betont, man habe die Rechtsform eines öffentlichen Vereins angenommen, bzw. sei von Kardinal Decourtray als solcher errichtet worden, um die Entschlossenheit zur Übernahme pastoraler Aufgaben zu unterstreichen. 123
Die Gemeinschaft hatte bald eine wachsende Zahl von Berufungen zum priesterlichen Dienst, die in einer institutionellen und rechtskonformen Weise in die Strukturen der Gemeinschaft integriert werden sollten. Zu diesem Zweck wurde ein klerikales Ordensinstitut diözesanen Rechts errichtet. Die Approbation erfolgte am 24. Juni 1992 durch Kardinal Decourtray. 124Hauptsitz des Ordensinstituts ist die Abtei Hautecombe. Das Klerikerinstitut wurde am 14. September 2009 von der Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und für die Gemeinschaften des apostolischen Lebens als ein klerikales Ordensinstitut päpstlichen Rechts anerkannt. 125Die Approbation galt zunächst ad experimentum für fünf Jahre und wurde danach unbefristet verlängert. 126Staatlicherseits bemüht sich der kirchliche Verein CCN, nach eigenen Aussagen, um eine Anerkennung, die je nach Gesetzgebung von Land zu Land unterschiedlich aussehen kann. Im Gründungsland Frankreich ist die Gemeinschaft durch einen Erlass des Innenministeriums vom 23. Juli 1993 als eine religiöse Kongregation anerkannt, mit dem Hauptsitz am Montée du Chemin Neuf 49 in Lyon. 127In Deutschland hat CCN die staatliche Rechtsform eines eingetragenen Vereins (e. V.) gewählt. 1994 wurde die Vereinssatzung vom Amtsgericht Berlin-Charlottenburg angenommen. 128Als Vereinsziel nennt die bürgerliche Satzung an vorderer Stelle in § 2, der Verein wolle seinen Mitgliedern die „Führung eines Lebens […] ermöglichen, das den Richtlinien des Evangeliums entspricht“. 129Als weitere Vereinszwecke werden zum Beispiel die christliche Familienarbeit, Glaubensseminare, christliche Jugendarbeit, und die Unterstützung von Projekten in der Dritten Welt benannt. Nach § 3 der Satzung verfolgt der Verein ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke. 130
7Die Zeitschrift Tychique erschien bis März 2003 zweimonatig. Verlagsort war die Zentrale des Chemin Neuf in der rue Henri IV in Lyon. Als Direktor und Herausgeber wurde Laurent Fabre genannt (vgl. http://www.chemin-neuf.org/tychique/[zit.: 24. Januar 2015]). Das Nachfolgemagazin FOI wird vom Chemin Neuf eigenen Medienverlag a.m.e. herausgegeben, der ebenfalls seinen Sitz in der rue Henri IV in Lyon hat. Die Abkürzung FOI ist aus den Anfangsbuchstaben von „Fratemité Oecuménique International“ gebildet. Das Akronym FOI ist zugleich ein Wortspiel. Die französische Vokabel „foi“ heißt auf Deutsch „Glaube“.
8Vgl. THE CHEMIN NEUF COMMUNITY, Origins, 30–34; ISAAC/DELTHIL, Commencement, 16– 27.
9Vgl. FABRE, Interview 1988, 177–191.
10Vgl. COUTELLIER, Commencements, 3–5.
11Ein Rückblick auf die Gründungszeit mit Anspruch auf historische Authentizität findet sich in der englischsprachigen Ausgabe des FOI 37/2013. Der Autor des Berichts wird, im Gegensatz zur üblichen Praxis im FOI, nicht namentlich genannt (vgl. THE CHEMIN NEUF COMMUNITY, Origins, 30–34).
Читать дальше