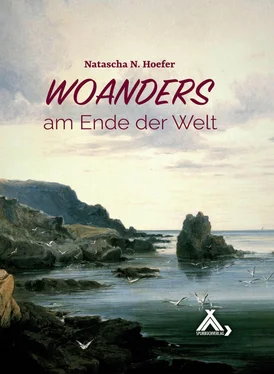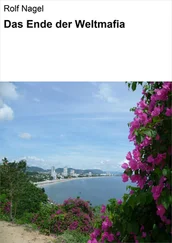»Meine Groß tante, Elodie, die Schwester meines Großvaters Erwann!«, empörte sich Marie nun doch wider Willen. Sie hatte ruhig bleiben wollen, aber erst die übliche Béatrice-Leier, und dann hatte er sich nicht einmal gemerkt, wer Elodie war!!
»Großtante Elodie – sollte ich die kennen?«, fragte Sylvain jetzt auch noch arglos. Aber dann schob er rasch nach: »Hör zu, mein herzliches Beileid natürlich, und jetzt erinnere ich mich, klar: Großtante Elodie aus Paris; das war die Modemacherin, die du mal im Altenheim besucht hast, oder?«
Marie nickte, sie konnte nicht reden, wischte sich stumm die Tränen weg.
Sylvain wollte sie in den Arm nehmen. »Ich wusste nicht, dass du ihr so nahe … Komm her, lass dich trösten.«
»Lass dich trösten – als ob das so einfach wäre!«, platzte es aus Marie heraus und sie stieß ihn weg. »Weißt du, wie ich mich auf dem Friedhof gefühlt habe? Vor ihrer Urnenwand – es war nicht mal ein echtes Grab, nur eine Urnenwand! Und sie hätte in der Bretagne beerdigt werden sollen, sie war Bretonin! Sie hat die Bretagne geliebt, diese ganze blöde Zeremonie in Paris war ganz falsch!«
»Mein armer Schatz. Warum hast du mir das nicht vorher erzählt?«
»Das hast du mir doch gerade erklärt – Béatrice hin, schwere Erkältung her! Du warst nicht sprechbereit. Aber diesmal stecke ich das nicht mehr weg, Sylvain. Vor Elodies Urne ist mir etwas klar geworden. Ein menschliches Leben ist zu kurz, um es mit so etwas wie unserer Affäre zu verschwenden.«
»Du weißt sehr gut, dass das zwischen uns mehr als eine Affäre ist.« Sylvain war blass geworden.
»Ich stand allein vor Elodies Urne. Natürlich, meine Familie war auch da; aber ich fühlte mich allein, auf mich zurückgeworfen. Ohne einen Lebensgefährten, der mit mir mitfühlen und dessen Liebe mich in meiner Trauer stützen würde.«
»Ich fühle mit dir mit. Immer. Jetzt.«
»Aber du warst nicht da! Niemand aus meiner Familie hat dich jemals gesehen. Niemand weiß von dir. Niemand von deiner Familie weiß von mir – natürlich nicht! Wir sind in niemandes Augen ein Paar, wir sind Schatten im Leben des anderen. Ich hätte dich gebraucht, bei dieser Bestattung, nicht als Schatten, sondern ganz real neben mir. Aber du warst nicht da.«
Sylvain blähte die Backen auf, rang die Hände.
»Und sag jetzt bitte nichts. Erneuere keine Versprechen, die du nicht halten willst. Du willst deine Frau in Wahrheit nicht verlassen. Jetzt sagst du, weil die Kinder noch da sind; aber wenn die einmal ausgezogen sind, wirst du sagen, du kannst Béatrice erst recht nicht allein lassen.«
»Marie, das…«
»Nein, ich bin noch nicht fertig!« Sie holte Atem. »Ich habe Elodies Haus und eine gewisse Summe geerbt. Damit kann ich mir meine Freiheit leisten. Es ist aus zwischen uns. Ich gehe fort aus Brest. Es tut mir leid, enorm leid für die Praxis. Aber es geht nicht anders.«
» Gehen ? Was soll das heißen, wohin willst du denn gehen?«
»Nach Mengleuff. Das ist auf Crozon.«
Sylvain schloss langsam die Augen, blinzelte, als wolle er aus einem Alptraum erwachen. »Marie, ich – ich kann nicht aufhören, dich zu lieben.«
Marie wandte sich ab und ging.
Wenn er sie aufhalten, wenn er sie an sich reißen, wenn er sich jetzt entscheiden würde, für sie! Aber er tat es nicht.

Marie startete den Wagen. Minuten lang hatte sie nur dagesessen und gehofft, inbrünstig gehofft, er würde noch kommen – darum kämpfen, sie nicht zu verlieren! Nicht einmal das.
In fiebriger Hast verließ sie das Zentrum der Großstadt, fuhr auf die Schnellstraße Richtung Quimper auf, zwang sich, wegen der Radarkontrollen nicht schneller als hundertzehn zu fahren.
Wie lange war sie nicht mehr in Mengleuff gewesen? An Elodies vierundachtzigstem Geburtstag, vor zehn Jahren, hatte diese verkündet, sie sei zu alt, um in die Bretagne zu fahren. Damit hatten Maries sommerliche Besuche bei ihrer Großtante aufgehört. Aber einmal noch war sie vor ein paar Jahren nach Mengleuff gefahren, um von außen das vereinsamte Haus ihrer Vorfahren zu sehen und sich in den verwilderten Garten zu schleichen, das Paradies ihrer Kindheit … Doch es hatte zu wehgetan, das Verwildern und den Verfall mitanzusehen und sich dabei zu sagen: Elodie wird nie mehr kommen; nie mehr, weil sie in einem Altenheim in Paris sitzt … und dort sitzen wird bis zu ihrem Tod.
Da war sie endlich, die Ausfahrt nach Châteaulin – auch hier war Marie ewig nicht mehr gewesen. Sie überquerte das Stadtzentrum und den breiten Fluss Aulne über die einstige Eisenbahnbrücke, verließ Châteaulin über die Weststadt wieder und bald wurde die Landschaft um sie wilder, rauer. Die Landstraße stieg an, um seitlich am Berg Ménez-Hom vorbeizuführen; dahinter erstreckte sich die Halbinsel Crozon, und dann dauerte es nicht mehr lange und Marie fuhr durch Telgruc, an der Dorfkirche vorbei, und dann Richtung Meer … Endlich kam der unscheinbare Abzweig, der rechts in die Senke hinunterführte und dann wieder hinauf, zu dem winzigen Dorf, das Mengleuff war. Marie holperte über den Feldweg, der ringförmig um den Dorfkern führte, und da lag es, das Haus. Elodies Haus – nein, ihres .
Sie verlangsamte, ließ den Blick über das alte Gemäuer aus Feldstein schweifen, hielt aber noch nicht an. Der Weg vor dem Haus war zum Parken zu eng. Sie fuhr um die nächste Kurve und hielt dort am Rand eines Feldes. Alles wie früher, stellte sie fest. Es gab ihr ein unerwartetes Gefühl der Ruhe.
Ohne Hast nahm sie den Schlüssel ihres Hauses aus dem Handschuhfach und stieg aus. Schwalben sirrten um sie herum, sie hörte die Schreie der Möwen, die höher als die Schwalben flogen. Das Brummen eines entfernten Traktors drang an ihr Ohr. In der Nähe zirpten Grillen. Sonst war es still.
Sie ging am Hof des Nachbarhauses vorbei und warf einen Blick hinüber. Das Haus stand leer, war in schlechtem Zustand. Dann wandte sie sich – und ihr Herz klopfte dabei – ihrem eigenen Haus zu. Kaum zu glauben, sie hatte ein Haus! Sie hatte nie zu hoffen gewagt, sich von ihrem kargen Einkommen ein Haus leisten zu können; aber dass Elodie an sie, Marie, gedacht hatte, dass sie selbst, Marie Cadiou, das alte Haus ihrer Vorfahren bewohnen würde …
Und es sah gar nicht so heruntergekommen aus, wie sie es befürchtet hatte. Der allgegenwärtige Efeu musste regelmäßig beschnitten worden sein, auch wenn das letzte Mal wohl ein Jahr her sein konnte, so wie das Grünzeug sich über die Regenrinne hinaus hochwand. Riesig geworden war das Hortensienmassiv, das um die rechte vordere Hausecke wuchs; aber leider war es vertrocknet. Oder doch nicht ganz? »Ich gieße euch gleich«, versprach Marie den Hortensien. Mit der Fingerspitze schabte sie ein Stück Farbe von einem geschlossenen Fensterladen. Blau, nicht mehr braun. Sie würde Tür und Läden blau streichen. Die duftenden Rosensträucher neben den Fenstern bogen sich weit über den Feldweg vor; sie mussten zurückgeschnitten werden, waren aber nicht vertrocknet. Marie sah nach oben. Das Schieferdach sah noch gut aus, zumindest auf dieser Seite des Hauses.
Sie steckte den Schlüssel in das alte Schloss und drehte. Die Tür schwang auf, ein Geruch nach Feuchtigkeit schlug Marie entgegen. Aber nicht so schlimm, wie sie befürchtet hatte. Wer auch immer den Efeu gebändigt hatte, er hatte hin und wieder gelüftet.
Im Halbdunkel tastete sie sich nacheinander zu den Fenstern, öffnete sie und schlug die Läden zurück. Ja, alles hier drinnen sah aus wie in ihrer Erinnerung, nur schien das Ganze geschrumpft zu sein. War dieser Raum, der Hauptraum des Hauses, schon immer so klein gewesen?
Читать дальше