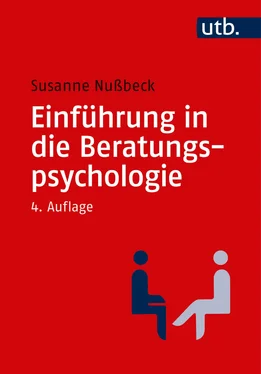Felder psycho-sozialer Beratung
Pädagogik und Soziale Arbeit sind nach wie vor die wichtigsten Felder psychologischer Beratung. Die Bereiche, in denen sie angeboten wird, weiteten sich jedoch aus. Seit den sechziger Jahren etablierte sich Bildungsberatung als neuer Zweig (Schröder 2004), der Orientierungs- und Entscheidungshilfen bei der Realisierung individueller und gesellschaftlicher Bildungsziele beinhaltet. Studienberatung als Weiterführung der Bildungsberatung entstand nicht zuletzt aufgrund sich immer weiter ausdifferenzierender Studienangebote, die kaum mehr überschaubar waren (Stiehler 2004). Selbsthilfegruppen zu allen Wechselfällen des Lebens formierten sich in den siebziger Jahren (W. Thiel 2004). Der Psychiatrie-Enquête (1975) folgten sozialpsychiatrische Reformen und entsprechende Beratungs- und Betreuungsangebote für psychisch kranke Menschen (v. Kardorff 2004). Beratung wird in vielen Feldern des sozialen Lebens als unabdingbar angesehen, und eine Beratungspflicht in manchen Bereichen auch zur Voraussetzung für Entscheidungen gemacht: So ist die Schwangerschaftskonfliktberatung bei gewünschtem Abbruch der Schwangerschaft seit 1976 vorgeschrieben (Koschorke 2004), vor die Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe oder der Agentur für Arbeit ist ein Beratungsgespräch gesetzt. Mit dem Drogenproblem, das seit den siebziger Jahren zu einem besonderen Problem der Jugendhilfe wurde, kamen Drogen- und Suchtberatungsstellen hinzu (Vogt / Schmid 2004). Heute gibt es Beratungsstellen für praktisch alle Lebens- und Problemlagen.
Ausbildung für Berater
Angesichts dieser Entwicklungen wird wohl niemand die Notwendigkeit einer Ausbildung in Beratungsmethoden und -kompetenzen bestreiten. Beratung wird in allen Feldern menschlicher Entwicklung und zwischenmenschlicher Konfliktmöglichkeiten und von Organisationen, die sich mit diesen Problemen befassen, als wichtiges Element angesehen. Weiterbildende, berufsbegleitende Studiengänge und Masterstudiengänge an (Fach)Hochschulen und privaten Hochschulen mit unterschiedlichen Schwerpunkten haben sich etabliert. In der Deutschen Gesellschaft für Beratung (DGfB) haben sich 21 Verbände zu einem Dachverband zusammengeschlossen und ein Konsenspapier zum Beratungsverständnis herausgegeben, das u.a. eine Weiterbildung auf der Grundlage eines wissenschaftlichen Studiums vorsieht und ständige Qualitätssicherung fordert (DGfB 2003). Der Trend geht also auch in Deutschland in Richtung auf eine vereinheitlichte und Qualitätsansprüchen genügende, anerkannte Ausbildung psycho-sozialer Berater.
Counseling in den USA
In den angloamerikanischen Ländern hat sich eine eigene Beratungswissenschaft schon länger etablieren können. In der von Witmer am Ende des 19. Jahrhunderts eröffneten psychologischen Klinik und der nachfolgenden Child-Guidance-Bewegung, die sich heilpädagogisch und erzieherisch Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten widmete, liegen ihre Ursprünge (Rechtien 2004b). Die Tatsache, dass psychisch kranken und entwicklungsgestörten Kindern durch therapeutische Interventionen geholfen werden konnte, veränderte den Blick in der Öffentlichkeit und führte in der Psychologie dazu, mehr auf das Entwicklungspotential zu achten als auf Defizite, die überwunden werden müssen (Gelso / Fretz 1999). Die Entwicklung zu einer eigenen Disziplin schlägt sich in den USA durch die Gründung einer Division „Counseling and Guidance“ der American Psychological Association (APA) bereits im Jahr 1946 nieder. Ausbildungsrichtlinien werden von der APA herausgegeben und sorgen so für einen professionellen Standard.
Counselling in Großbritannien
In England wurde 1970 die „Standing Conference for the advancement of counselling“ gegründet, die 1977 in die British Association for Counselling (BAC) überging. Im Jahr 2000 wurde mit der Erweiterung des Namens in British Association for counselling and psychotherapy (BACP) die fachliche Nähe von Beratern und Therapeuten deutlich, die in England gegenüber dem Ratgeben, Überwachen und der Sozialen Arbeit stärker als in Deutschland betont wird (Feltham 2004). 2018 wurde das „Ethical framework“ überarbeitet, wobei insbesondere ein evidenzbasiertes Vorgehen in der Beratung betont wird (BACP 2018).
Empowerment
Im Zuge der in den sechziger Jahren in den USA entstandenen „Community Psychology“, im Deutschen als Gemeindepsychologie übersetzt, kam der Empowerment-Gedanke (Rappaport 1985) in die Beratungskonzepte. In der Gemeindearbeit ging es zunächst um ein gemeindenahes Versorgungssystem zur Bekämpfung von Rassenunruhen und Armut. Heute wird unter Empowerment, „Selbstbefähigung“, meist die „Hilfe zur Selbsthilfe“, das Wecken eigener Ressourcen der Ratsuchenden, verstanden. Der Blick auf die Stärken statt auf die Defizite der Klientel führt zu einer veränderten Sicht des Beratungsauftrages. Die Förderung von Ressourcen und Gesundheit der Klienten steht heute stärker im Mittelpunkt der Beratung (Brandes/Stark 2019).
Supervison
Seit Beginn der neunziger Jahre spielt Qualitätssicherung in den heute vielfältigen Beratungsanlässen und -institutionen eine immer bedeutendere Rolle (Vogel 2004). Besonders die verschiedenen Formen der Supervision haben sich hier etabliert (Pühl 2004). Beratung hat sich von einer reinen Informationsvermittlung und Anleitung zu normkompatibler Lebensführung zu differenzierten Konzepten gemeinsamen Problemlösens unter wissenschaftlichen Standards und Kontrolle entwickelt.
1.2Aktuelle Definitionen von Beratung
Beratung ist ein der Alltagssprache entlehnter Begriff. Man berät sich, wenn mehrere Personen mit einer Sache befasst sind, man sucht den Rat eines Vertrauten, von dem man annimmt, dass er einem wohl gesonnen ist, manchmal erhält man ungebeten gut gemeinte Ratschläge und manchmal wird sogar gedroht: „Ich rate dir gut …!“. Ge- und beraten wird in allen Lebenslagen und in allen Bereichen: Finanzberatung, Ernährungsberatung, Rechtsberatung, Berufsberatung, Studienberatung, Modeberatung … – die Liste könnte beliebig fortgesetzt werden. Beratung als Vermittlung von Informationen und Anstoß zu Veränderungen findet sich mehr oder weniger explizit und institutionalisiert in praktisch allen Berufsfeldern, wohingegen ausgearbeitete Konzepte eher selten sind.
Gibt man in eine Literatursuchmaschine den Begriff „Ratgeber“ ein, erhält man eine Flut von Treffern, die die Zahl von 10.000 deutlich überschreitet. Von der „Anleitung zum Unglücklichsein“ (Watzlawick 1983) über die „Entdeckung der Faulheit“, Ratschläge sich bei der Arbeit möglichst wenig anzustrengen (Maier 2005), bis hin zu konkreten Ratgebern für alle Wechselfälle des Lebens findet man mehr oder weniger brauchbare Titel, deren Autoren oft trivialen psychologischen Erklärungsmustern folgen und ihre Lebensweisheiten beratend weitergeben wollen.
Was aber unterscheidet diese Art der Beratung von professioneller, psychologischer Beratung? Psychologisch-pädagogische Beratung geht über das reine Übermitteln von Informationen hinaus. Sie ist

Beratung
„ein zwischenmenschlicher Prozess (Interaktion), in welchem eine Person (der Ratsuchende oder Klient) in und durch die Interaktion mit einer anderen Person (dem Berater) mehr Klarheit über eigene Probleme und deren Bewältigung gewinnt. Das Ziel der Beratung ist die Förderung von Problemlösekompetenz.“ (Rechtien 2004b, S. 16)
Beratung spielt sich also immer in einem Interaktionsprozess zwischen zwei Menschen ab, welcher Art die Interaktion ist und welche Kompetenzen den Berater befähigen, die Problemlösekompetenz des Ratsuchenden zu fördern, bleibt in dieser Definition jedoch offen. Dietrich (1983) definiert wesentlich differenzierter:
Читать дальше