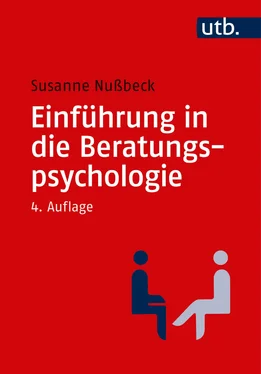Erfreulicherweise wird auch der Evaluation und Interventionsforschung ein eigenes Kapitel gewidmet. Es gibt nach wie vor einen Mangel an fundierter Forschung zu Beratungsprozessen, der mit daran liegen mag, dass es kaum universitäre Professuren für Beratung gibt. Die klinisch-psychologische Forschung beschäftigt sich mit den Effekten von Psychotherapie, so dass das viel größere, vielleicht auch komplexere, Praxisfeld der Beratung vernachlässigt wird. Hinzu kommt, dass in der Praxis häufig ein Misstrauen gegenüber Forschung vorzufinden ist, da bezweifelt wird, ob sich ein komplexes Beratungsgeschehen adäquat in der Forschung abbilden lässt. In der Psychotherapieforschung waren ähnliche Bedenken von der Praxis vorgetragen worden, die sehr anspruchsvolle Forschungsmethodenentwicklungen zur Folge hatten. Es wäre äußerst wünschenswert, wenn es einen entsprechenden Entwicklungsschub auch in der Beratungsforschung geben würde.
In Kapitel 7 werden die Beratungsfelder Erziehung und Familie, Schule, Aus- und Weiterbildung, Entwicklung und Frühförderung, Behinderung und chronische Krankheit, Abhängigkeit und Sucht sowie die Beratung von Menschen mit Migrationshintergrund fokussiert. Das Buch schließt mit der Beschreibung aktueller Entwicklungen, einem Glossar und einer umfangreichen Literaturliste.
Susanne Nußbeck gelingt es, komplexe Sachverhalte sowohl in verständlicher Sprache als auch auf hohem wissenschaftlichen Niveau darzustellen. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis machen ihren Text sehr anschaulich und sie greift aktuelle Entwicklungen kompetent auf. Ein Beispiel dafür ist ihre differenzierte Diskussion der Vor- und Nachteile von Online- Beratungsangeboten, deren Verbreitung und somit Bedeutsamkeit erheblich zunehmen wird. Kurzum: Die Leserinnen und Leser gewinnen einen umfassenden, fundierten Einblick in die vielfältigen Themenfelder der psychosozialen Beratung. Ihren Kenntnisgewinn können sie anhand der Übungsfragen am Ende der Kapitel selber überprüfen und sie werden feststellen, dass sie bei aufmerksamer Lektüre viel gelernt haben. Etwas Besseres lässt sich über ein Lehrbuch nicht sagen.
Köln, im Juli 2019 Prof. Dr. Susanne Zank
1 Einführung
Beratung hat eine lange Tradition in vielen Lebensbereichen. Im einführenden Kapitel erhält der Leser einen Überblick über die Entwicklung der Beratungswissenschaften, wie sie sich in der Geschichte in Deutschland und in den angloamerikanischen Ländern darstellt, und darüber, welche Themen heute aktuell sind. „Beratung“ wird von verschiedenen Autoren mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung definiert. Abgrenzungen zu „Therapie“ auf der einen und „Mediation“ auf der anderen Seite, die beide ebenso wie die Beratung auf Veränderungen zielen, von denselben Berufsgruppen ausgeübt werden, oft denselben theoretischen Hintergrund haben und sich häufig gleicher Mittel bedienen, stellen das Spezifische des Konzeptes „Beratung“ heraus. Beratungen geschehen in Kommunikation mit Menschen, die sich in einer Phase der Entscheidungsnot oder Orientierungslosigkeit befinden. Dem Berater kommt daher eine hohe ethische Verantwortung zu, seine Position nicht auszunutzen und dem Klienten nicht zu schaden.
1.1Historische Entwicklung
Beratung ist ein allgegenwärtiges und zeitloses Phänomen. Jeder Herrscher hatte und hat seine Berater, für jeden Anlass finden sich kundige Experten. Mehr oder weniger seriöse Beratung kann man für alle Lebenslagen erhalten. Professionelle Beratung hingegen findet häufig im pädagogisch-psychologischen Bereich und in der Sozialen Arbeit statt, wo sie schon früh institutionalisiert wurde. In der Familien- und Jugendfürsorge gibt es Beratung seit Ende des 19. Jahrhunderts. Seither hat sie einen umfassenden Wandel in ihren Grundannahmen und Zielen durchgemacht.
Geschichte der Erziehungsberatung
Schon im Kaiserreich gab es Beratungen für die Betreuung unehelicher Kinder und Waisenkinder, „Kinderrettungsvereine“, deren „Reiseagenten“ beratende Hausbesuche bei ihrer hilfsbedürftigen Klientel machten (Sommer 1995). Stellen, die für „Beratung in Fragen der Erziehung“ zuständig waren, wurden in Deutschland nach dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1922 etabliert (Schröder 2004). Die damit verbundenen staatlichen Eingriffsmöglichkeiten in die Familien, die damals – wie auch heute noch – besonders sozial schwache Familien trafen, wurden abgeleitet aus der Maxime, dass jedes deutsche Kind ein Recht auf Erziehung zur leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit habe (Sommer 1995). Zur Überwachung dieses Anspruchs wurden in den Städten Jugendämter gegründet, deren Leiter meist Verwaltungsfachleute ohne sozialpädagogische Ausbildung waren. Den Jugendämtern angegliedert entstanden Erziehungsberatungsstellen, die oft unter der Leitung von Kinderärzten oder Psychiatern standen (Sommer 1995).
1931 gab es neben den Beratungsstellen der Jugendämter mehr als 100 freie oder kirchliche Erziehungsberatungsstellen (Dietzfelbinger et al. 2003). Beratung umfasste zu der Zeit überwiegend konkreten Informationsbedarf und die Sicherung des Lebens unter als allgemein gültig angenommenen sozialen Norm- und Wertvorstellungen in den Bereichen Bildung, Erziehung, Leben und Beruf (Großmaß 2004b) und verstand sich weniger als Interaktion zwischen Berater und grundsätzlich gleichberechtigten und eigenverantwortlichen Menschen in kritischen Lebenssituationen denn als Hüter einer den gesellschaftlichen Normen entsprechenden Lebensweise.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die in der NS-Zeit gleichgeschalteten und teilweise geschlossenen Beratungsstellen neu gegründet oder umgestaltet. In den fünfziger Jahren gab es Beratungsstellen für Kinder und Jugendliche und deren Eltern als Erziehungsberatungsstellen auf kommunaler Ebene oder in kirchlichen Trägerschaften. Ehe-, Familien- und Lebensberatung wird jedoch auch noch am Anfang des 21. Jahrhunderts weiterhin überwiegend von den Kirchen angeboten. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Erziehungsberatung immer noch eher ein autoritäres Fürsorgesystem, in dem Beratung der normativen Lenkung diente (Großmaß 2004b). Nach 1970 nahm die Zahl der Erziehungsberatungsstellen deutlich zu. Im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) wurde dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung getragen. Vielfältige Lebensentwürfe werden heute akzeptiert, die sich nicht allgemein gültigen Normen unterordnen lassen. Erziehungsberatung wird im Sinne von Hilfe zur Konfliktlösung als Anspruch an die Jugendhilfe festgeschrieben (Menne 2017).
Geschichte der Berufsberatung
Ein zweiter Strang institutionalisierter Beratung in Deutschland entstand 1927 mit dem „Gesetz über die Einrichtung der Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung – AVAVG“. Damit wurde die staatliche Berufsberatung eingeführt (R. Thiel 2004), die bis 1997 ein Monopol der Arbeitsverwaltung blieb. Die Aufgaben der Berufsberatung waren zunächst die Vermittlung von Lehrstellen und Arbeitskräften (Schröder 2004). Infolge der Ausdifferenzierung des Arbeitsmarktes und der zunehmend vielfältigeren beruflichen Anforderungen wurden später auch individuelle und gesellschaftliche Probleme in die Berufsberatung einbezogen. Sie wurde damit zur Einzelberatung, zur Hilfe zur Selbsthilfe, fast eine „Kurztherapie“ bei Vermittlungsproblemen, die in der Person des zu Vermittelnden gesehen werden. Assessments, testpsychologische Feststellung der Fähigkeiten, um Personen an Stellen anzupassen, wurden weitere Bereiche der Berufsberatung.
Wandel des Verständnisses von Beratung
In den sechziger und siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts kam es aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen, die durch die Studentenbewegung von 1968 ausgelöst wurden, zu einem intensiven Ausbau des Beratungsangebotes, das dann zunehmend psycho-soziale Beratung umfasste (Schröder 2004). Beratung wird nun ein stärker psychologisches Hilfeangebot, das sich an den Bedürfnissen und Problemlagen der Klientel orientiert. Die Vermittlung von Informationen und das Anpassen an Wertvorstellungen der Gesellschaft traten in den Hintergrund und Beratung rückte in die Nähe von psychotherapeutischen Verfahren. Besonders die Anregungen aus der humanistischen Psychologie wurden übernommen und die Techniken der klientzentrierten, nicht-direktiven Gesprächsführung werden bis heute als Basisqualifikation für Psychologen und Sozialpädagogen angesehen. Mit der systemischen Sicht auf Familien und andere Gruppierungen, in denen Menschen leben, änderte sich der Blick auf die Problemlagen. Nicht mehr die einzelne Person steht im Vordergrund der Erziehungs-, Ehe- oder Lebensberatung, sondern das System, in dem die Person lebt und das sie mit konstituiert.
Читать дальше