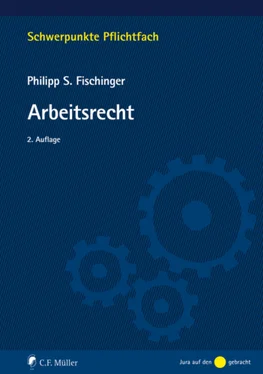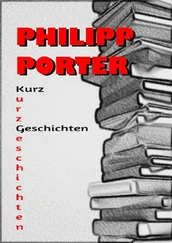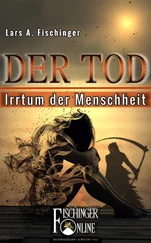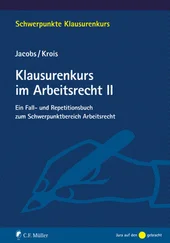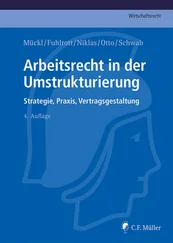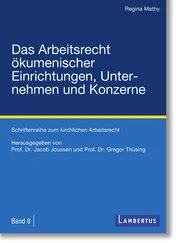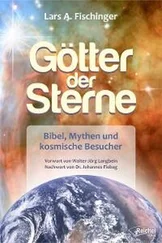1 ...6 7 8 10 11 12 ...36
I. Bedeutung des Arbeitnehmerbegriffs
17
Der Arbeitnehmerbegriff ist von überragender Bedeutung, denn das Arbeitsrecht ist das Sonderprivatrechtder Arbeitnehmer. Es handelt sich also – wie beim Verbraucherschutzrecht und dem Handelsrecht[1] – um ein subjektives System, um eine personell anknüpfende Rechtsmaterie, deren Rechtsnormen im Grundsatz nur für Sachverhalte Geltung beanspruchen, bei denen ein Arbeitnehmer in einem Arbeitsverhältnis beteiligt ist. Weil das Arbeitsrecht (aus Sicht des Arbeitnehmers) über das allgemeine Zivilrecht weit hinausreichende Schutzinstrumente bietet bzw. – aus Sicht des Arbeitgebers – erhebliche Beschränkungen statuiert, ist die Frage nach der Arbeitnehmereigenschaft von höchster praktischer Bedeutung, so dass v.a. in Grenzfällen oft erbittert über sie gestritten wird. Dabei stellt sich weniger ein Definitionsproblem – der Arbeitnehmerbegriff ist im Prinzip theoretisch weitestgehend geklärt –, sondern vielmehr ein Subsumtionsproblemim Einzelfall.[2]
18
Dieses wird durch zwei Umstände noch verstärkt: So ist die Entscheidung über die Arbeitnehmereigenschaft eine Frage des „alles oder nichts“, gibt es doch kein „ein bisschen Arbeitnehmer“[3] (aber: arbeitnehmerähnliche Person, Rn. 43 ff.). Überdies gilt im Arbeitsrecht grundsätzlich ein einheitlicher Arbeitnehmerbegriff. Wer also z.B. i.S.d. KSchG Arbeitnehmer ist, ist es auch im EFZG und im Kollektivarbeitsrecht; etwas anderes gilt unter dem Einfluss der Rechtsprechung des EuGH allerdings v.a. für Organmitglieder im unionsrechtlich geprägten Bereich (s. näher Rn. 51). Im Gegensatz dazu spielt der Arbeitgeberbegriffeine untergeordnete Rolle, er taucht lediglich als Korrelatbegriff in dem Sinne auf, dass Arbeitgeber ist, wer mindestens einen Arbeitnehmer beschäftigt (näher Rn. 63 ff.).
19
Während der Arbeitnehmerbegriff über Jahrzehnte nicht gesetzlich definiertwar, enthält nun erstmals seit dem 1.4.2017 § 611a I BGBeine nähere gesetzliche Ausgestaltung.[4] In weitestgehender Übereinstimmung mit der h.M. in Rechtsprechung und Literatur ist danach Arbeitnehmer, wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags( Rn. 20) zur Dienstleistung( Rn. 22 ff.) verpflichtet ist und dabei unselbstständig in persönlicher Abhängigkeit( Rn. 27 ff.) tätig wird.
Klausurhinweis:
Auf die Arbeitnehmereigenschaft anhand der folgenden Voraussetzungen ist nur einzugehen, wenn diese nach dem Sachverhalt zweifelhaft erscheint. Ist im Sachverhalt hingegen von „Arbeitsverhältnis“ oder „Arbeitnehmer“ die Rede, ohne dass Anhaltspunkte bestehen, dass diese problematisch wären, ist eine Erörterung der Arbeitnehmereigenschaft überflüssig und zeugt von falscher Schwerpunktsetzung!
§ 2 Arbeitnehmerbegriff und andere Begriffe› A. Grundlagen und Arbeitnehmerbegriff › II. Voraussetzungen der Arbeitnehmereigenschaft
II. Voraussetzungen der Arbeitnehmereigenschaft
1. Privatrechtlicher Vertrag
20
Arbeitnehmer kann nur sein, wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages tätig wird. Damit fallen die Dienstverhältnisse von Beamten, Richtern und Soldatenaus dem Anwendungsbereich des Arbeitsrechts heraus, weil ihre Beschäftigung im öffentlichen Recht wurzelt (vgl. Art. 33 IV GG); hingegen sind die sog. Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst (z.B. Universitätssekretärin) Arbeitnehmer, wird mit ihnen doch trotz der Beschäftigung bei einem öffentlich-rechtlichen Rechtsträger ein privatrechtlicher Arbeitsvertrag geschlossen. Keine Arbeitnehmer sind wiederum Strafgefangene, wenn sie freiwillig oder zwangsweise Arbeit leisten (vgl. § 37 StVollZG), Freiwilligenach dem BFDG, Entwicklungshelfer, Jugendfreiwillige(freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr), Ein-Euro-Jobber(§ 16d VII 2 SGB II) sowie Personen in sog. Wiedereingliederungsverhältnissen(§ 74 SGB V).
21
Ebenfalls kein Arbeitsverhältnis liegt vor, soweit ein Familienangehörigeraufgrund familienrechtlicher Vorschriften (§§ 1353 I 2, 1360 bzw. § 1619 BGB) im Betrieb des Ehegatten bzw. der Eltern tätig wird, ist Grundlage der Tätigkeit hier doch eine gesetzliche Verpflichtung und kein privatautonomer Arbeitsvertrag; geht die Dienstleistung aber über das gesetzlich Geschuldete hinaus, kann insoweit ein Arbeitsverhältnis vorliegen.[5]
2. Verpflichtung zur Dienstleistung
22
Der privatrechtliche Vertrag muss auf die Leistung von Diensten für einen anderen gerichtet sein, § 611a I 1 BGB. Der Arbeitsvertrag erweist sich somit als Unterfall des Dienstvertrages(§ 611 BGB), der wiederum drei Charakteristika aufweist:
23
(1)Die Tätigkeit muss entgeltlicherbracht werden. Der Dienstvertrag ist insoweit vom unentgeltlichen Auftrag(§ 662 BGB), der unentgeltlichen Geschäftsbesorgung sowie vom Ehrenamtabzugrenzen, für die i.d.R. nur Auslagenersatz und eine geringe, den Tätigkeitsaufwand nur symbolisch entlohnende „Vergütung“ gezahlt wird. Zu beachten ist aber § 612 I BGB, wonach eine Vergütung stillschweigend als vereinbart gelten kann mit der Folge, dass das Vorliegen eines Dienstvertrages nicht an der fehlenden Vergütungsabrede scheitert (näher Rn. 370 ff.).
24
(2)Im Unterschied zum Werkvertrag ist nur eine Dienstleistungals solche geschuldet, nicht aber deren Erfolg. Während der Werkunternehmer den Erfolg der versprochenen Leistung („Werk“, vgl. § 631 II BGB, z.B. Reparatur der Heizung) schuldet und im wahrsten Sinne des Wortes nur dann sein Entgelt „verdient“, wenn ihm dieser gelingt (vgl. §§ 641 I, 640 BGB), ist der Dienstvertrag tätigkeitsbezogen („Wirken“), der Dienstverpflichtete erfüllt seine Leistungspflichten also mit Erbringung der geschuldeten Dienste, unabhängig davon, ob diese zu dem vom Dienstberechtigten intendierten Erfolg führen; entsprechend hat er seine Vergütung auch dann „verdient“, wenn der Erfolg ausbleibt (vgl. § 614 S. 1 BGB, der nur auf die „Leistung der Dienste“ abstellt).[6] Was gewollt ist, ist durch Auslegung des Parteiwillens zu ermitteln, wobei es nicht auf die Bezeichnung (im Vertrag), sondern auf die tatsächliche Vertragsdurchführung ankommt, § 611a I 6 BGB.
Hinweis:
Auch im Rahmen von Arbeitsverhältnissen können erfolgsbezogene Vergütungssysteme(z.B. Akkord, Zielvereinbarungen) vereinbart werden. Diese stehen der Einordnung als Arbeitsvertrag nicht entgegen, ändern sie doch nichts daran, dass der Arbeitnehmer nur zur Dienstleistung verpflichtet ist – so dass mit ihrer Erbringung der Anspruch des Arbeitgebers nach § 362 I BGB erlischt –, nicht aber einen Erfolg schuldet; bleibt Letzterer aus, so verletzt er folglich nicht seine Vertragspflichten, er erhält „lediglich“ keinen Lohn!
25
(3)Die Dienstleistung muss für einen anderenerfolgen. Anhand dieses Merkmals ist der Dienstvertrag insb. von Dienstleistungen auf Basis eines Gesellschaftsverhältnissesabzugrenzen. Nach § 706 III BGB kann der Beitrag von Gesellschaftern auch in Dienstleistungen für die Gesellschaft bestehen (vgl. § 58 Nr. 2 BGB für Vereine); diese werden nicht – wie von § 611 BGB vorausgesetzt – für einen anderen erbracht, sondern zur Förderung des gemeinsamen Gesellschaftszwecks (§ 705 BGB).[7]
26
Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass zwischen der Gesellschaft und dem Gesellschafter neben dem Gesellschaftsverhältnis ein Arbeitsvertrag vereinbart wird. Arbeitnehmer kann aber nicht sein, wer so großen Einfluss auf die Führung der Gesellschaft hat, dass er letztlich über die Leitungsmacht verfügt (insb. Mehrheitsgesellschafter [Anteil über 50 %] und Minderheitsgesellschafter mit Sperrminorität).[8] Denkbar ist ein Arbeitsvertrag aber bei einem Kommanditisten, der dem Komplementär der KG gegenüber weisungsunterworfen ist.
Читать дальше