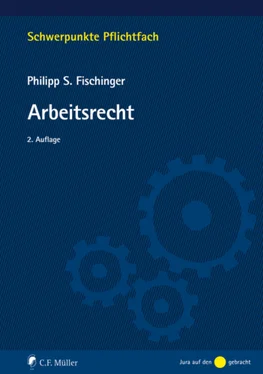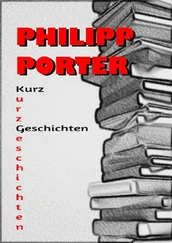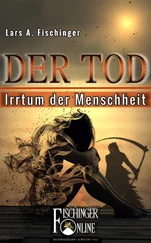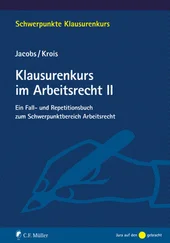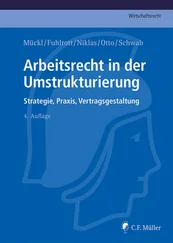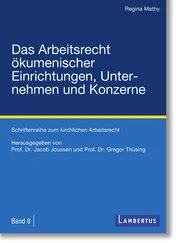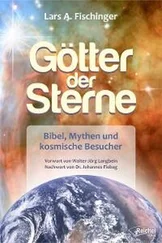§ 1 Einleitung› D. Rechtsquellen des Arbeitsrechts
D. Rechtsquellen des Arbeitsrechts
10
Das Arbeitsrecht ist (leider) eine äußerst zersplitterte Rechtsmaterie, was es dem erstmals sich mit ihr beschäftigenden Studierenden nicht einfach macht. Ein Arbeitsgesetzbuch als geschlossene Kodifikation fehlt, es muss daher schon auf der Ebene des einfachen Gesetzesrechts – neben dem BGB – auf eine Reihe von Spezialkodifikationenzurückgegriffen werden, die z.T. für (fast) alle Arbeitnehmer gelten (z.B. KSchG, §§ 14 ff. TzBfG), z.T. aber auch nur für spezielle Arbeitnehmer bzw. solche in besonderen Situationen Anwendung finden (z.B. MuSchG, §§ 6-13 TzBfG); die für die Prüfung relevanten Gesetze sind in der dtv-Textsammlung „Arbeitsgesetze“ abgedruckt. Die Rechtsbeziehungen der Arbeitsvertragspartner werden darüber hinaus durch eine deutlich größere Zahl unterschiedlicher Rechtsquellengeprägt als im allgemeinen Zivilrecht üblich. Zu nennen sind Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen, das Weisungsrecht des Arbeitgebers (§ 106 GewO) sowie Betriebsübung und Gleichbehandlungsgrundsatz (näher dazu Rn. 302 ff. und Rn. 335 ff.). Ferner spielt das Richterrechteine herausragende Rolle. Das gilt zunächst für die Auslegung und Anwendung des existierenden Gesetzesrechts. Darüber sind aber zwei wichtige Bestandteile des Arbeitsrechts allein richterrechtlich entwickelt worden, nämlich die Beschränkung der Arbeitnehmerhaftung (Rn. 724 ff.) sowie das Arbeitskampfrecht. Schließlich sind auch die „übergeordneten“ Rechtsquellen, also Verfassungs-und Europarecht, im Vergleich zum Zivilrecht von größerer Bedeutung.
§ 1 Einleitung› E. Konzeption dieses Lehrbuchs
E. Konzeption dieses Lehrbuchs
11
Das vorliegende Lehrbuch verfolgt nicht den Anspruch, das Arbeitsrecht in seiner gesamten Breite (vertieft) darzustellen. Vielmehr hat es – ganz im Wortsinne eines Bands der „Schwerpunkte-Reihe“– zum Ziel, diejenigen Bereiche herauszugreifen und intensiv sowie klausur-didaktisch vertieft zu erläutern, die als klausur- und examensrelevant zu bezeichnen sind. Bereiche, die erfahrungsgemäß keine oder nur sehr geringe Examensrelevanz aufweisen, bleiben entweder vollständig ausgeblendet oder werden nur überblicksartig dargestellt (z.B. Kollektives Arbeitsrecht, betriebliche Altersversorgung, Datenschutzrecht, Geschichte des Arbeitsrechts).
12
Zwei Hinweise zum Umgang mit dem vorliegenden Buch: Da es sich sowohl an den Einsteiger als auch den Examenskandidaten, der an einer vertieften Aufbereitung der examensrelevanten Fragestellungen interessiert ist, wendet, ist es in gewisser Weise zweigeteilt: Während „normale“ Randnummern sich an beide Adressatengruppen richten, enthalten die vom Grundlagentext auch drucktechnisch abgesetzten Passagen weitergehende Ausführungen, die der Vertiefungdes Grundlagenstoffs dienen. Sie sind mit „V“gekennzeichnet.
[1]
Im Folgenden wird ausschließlich die männliche Form verwendet, erfasst sind selbstverständlich aber auch Frauen sowie Personen des dritten Geschlechts.
[2]
Vgl. Fischinger , Handelsrecht, § 1, Rn. 1.
[3]
Einige Teile des Arbeitsrechts sind allerdings – wie insb. das Arbeitsschutzrecht (z.B. ASiG) – Öffentliches Recht.
[4]
BVerfG 23.4.1986 – 2 BvR 487/80, NJW 1987, 827, 828.
[5]
BVerfG 6.10.1987 – 1 BvR 1086/82, NJW 1988, 1195, 1199.
[6]
Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 001 vom 4.1.2016; Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.8, 2015.
[7]
Vgl. EuGH 5.10.2004 – C-397/01, NZA 2004, 1145, 1149; BVerfG 26.6.1991 – 1 BvR 779/85, BVerfGE 84, 212, 229; BAG 16.3.1994 – 5 AZR 339/92, NZA 1994, 937, 940.
[8]
Krause , Arbeitsrecht, § 1, Rn. 9.
[9]
Von einem detaillierten historischen Überblick wird hier mangels Examensrelevanz abgesehen. Weil die Kenntnis der historischen Grundlagen aber für das Verständnis des geltenden Rechts unabdingbar ist, seien zur Lektüre insoweit z.B. empfohlen: MüHdbArbR/ Richardi , § 2, passim; Richardi , Arbeitsrecht als Teil freiheitlicher Ordnung (passim).
[10]
Vgl. zur Geschichte des Arbeitsrechts z.B. Richardi , Arbeitsrecht im Wandel der Zeit, passim.
§ 2 Arbeitnehmerbegriff und andere Begriffe
§ 2 Arbeitnehmerbegriff und andere Begriffe
Inhaltsverzeichnis
A. Grundlagen und Arbeitnehmerbegriff
B. Arbeitnehmerähnliche Personen
C. Besondere „Arten“ von Arbeitsverhältnissen
D. Der Arbeitgeber und seine Organisation
13
Fall 1:
A ist bei Unternehmerin U als Softwaredesigner tätig, obwohl er nie eine formelle Ausbildung hierzu absolviert hat. Nach seinem Vertrag, in dem er als „freier Mitarbeiter“ bezeichnet wird, soll er nur „nach Bedarf“ für U tätig werden, wobei die konkreten Arbeitsaufträge immer montags um 9:00 Uhr über das Intranet bekannt gegeben werden. A ist sodann frei, wo und wann er diese ausführt, ihm wird lediglich ein zeitlicher Rahmen (in der Regel 3-5 Tage), das Ziel des Auftrags und die ungefähre Art der Ausführung vorgegeben. A nutzt die spezielle Software der U, wobei er während eines Arbeitsauftrags regelmäßig einem Vorgesetzten Fortschritte bzw. Probleme melden muss. Im Schnitt arbeitet A ca. 30 Stunden pro Woche für U, wohingegen die normalen Arbeitnehmer dort 40 Wochenstunden leisten. Vergütet wird A – nach entsprechender Abrechnung – erfolgsunabhängig pro Stunde (je € 50). Die U führt für A keine Sozialversicherungsbeiträge und Einkommensteuer ab. Bezahlten Erholungsurlaub oder Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall hat A in der Vergangenheit nicht erhalten. Auch wenn ihm letzteres egal sein könnte, da er als Millionenerbe über genügend Geld verfügt, fragt er sich, ob ihm im Falle einer Erkrankung nicht doch ein Anspruch aus § 3 EFZG zustehen könne? ( Lösung Rn. 37)
14
Fall 2:
A ist Auszubildender bei Unternehmer U. Um sich ein „Zubrot“ zu verdienen, arbeitet er samstags sechs Stunden bei K, der ein Konkurrent von U ist und setzt dabei seine während der Ausbildung gelernten Kenntnisse ein. Als U das erfährt, verlangt er Unterlassung wegen unzulässiger Konkurrenztätigkeit. A wendet ein, er als Auszubildender unterläge keinem Konkurrenzverbot. Wer hat Recht? ( Lösung Rn. 53)
15
Fall 3:
A ist als Leiharbeitnehmer bei der Personalagentur „faire Arbeit“ (P) angestellt, die ihn mit seiner Einwilligung an Unternehmer U „verleiht“. Über eine Genehmigung zur Arbeitnehmerüberlassung verfügt P, deren Geschäftsführer dies für „unnötigen Papierkram“ hält, nicht. Zwischen wem liegt ein Arbeitsverhältnis vor? ( Lösung Rn. 59)
16
Fall 4:
A ist als Arbeitnehmer in einer Produktionsstätte für Kamera-Zubehör im schwäbischen Ellwangen („Fotowerkstatt Ellwanga“) tätig. Diese gehört der Foto-Porst GmbH, die u.a. in Stuttgart ein Verkaufslokal betreibt. Die Foto-Porst GmbH gehört zu einem größeren Unternehmensverbund, die alle unter dem Dach der Foto-Deutschland AG vereinigt sind. Wer ist Arbeitgeber des A? ( Lösung Rn. 67, 69 und 74 )
§ 2 Arbeitnehmerbegriff und andere Begriffe› A. Grundlagen und Arbeitnehmerbegriff
A. Grundlagen und Arbeitnehmerbegriff
§ 2 Arbeitnehmerbegriff und andere Begriffe› A. Grundlagen und Arbeitnehmerbegriff › I. Bedeutung des Arbeitnehmerbegriffs
Читать дальше