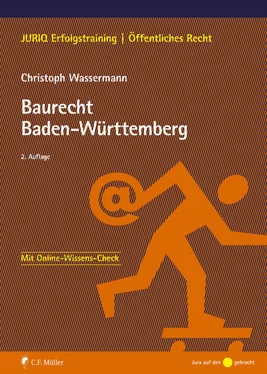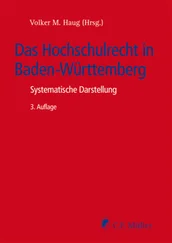I. Ermächtigungsgrundlage
112
Da die Festsetzungen in einem Bebauungsplan Inhalts- und Schrankenbestimmungen i.S.d. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG darstellen, bedürfen diese nach dem Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes einer (formell-)gesetzlichen Grundlage. Ermächtigungsgrundlage für die Aufstellung eines Bebauungsplanes sind §§ 1 Abs. 3 S. 1, 2 und 2 Abs. 2 S. 1 BauGB.
3. Teil Kommunale Bauleitplanung› C. Die Rechtmäßigkeit eines Bebauungsplanes und die Folgen eines Verstoßes gegen Vorschriften des BauGB› II. Formelle Rechtmäßigkeit
II. Formelle Rechtmäßigkeit
113
Im Rahmen der Zuständigkeit ist zwischen zwei Formen der Zuständigkeitzu unterscheiden, die Ihnen aus dem Kommunalrecht bekannt sein sollten: Der Verbands- und der Organkompetenz.
a) Verbandskompetenz, §§ 2 Abs. 1 S. 1, 1 Abs. 3 BauGB
114
Nutzen Sie die Chance und wiederholen Sie die Zuständigkeitsverteilung zwischen Gemeinderat und Bürgermeister.
Unter dem Begriff der Verbandskompetenzwird die Frage behandelt, welcher Verband aus der Gesamtheit der öffentlichen Gewalt für die Aufstellung des Bauungsplanes zuständig ist.[1] Gemäß §§ 2 Abs. 1 S. 1, 1 Abs. 3 BauGB steht den Gemeindenals Träger der Planungshoheit in ihrem Gemeindegebiet die Verbandskompetenz zu.
Ausnahmen von der Verbandskompetenz der Gemeinde finden sich in §§ 203–205 BauGB. Diese sind jedoch wenig klausurrelevant.
JURIQ-Klausurtipp
Aus dem Rechtsstaats- und Demokratieprinzip folgt, dass ein rechtswidriger belastender Verwaltungsakt grundsätzlich nichtig ist, da durch einen solchen ein Grundrechtseingriff nicht rechtfertigt werden kann ( Nichtigkeitsdogma).[2] Demgemäß führt auch ein Verstoß gegen Verfahrensvorschriften zur Rechtswidrigkeit und damit zur Nichtigkeit.
Für den Bebauungsplan ist dieser Grundsatz wegen der Planerhaltungsvorschriften der §§ 214, 215 BauGB quasi zur Ausnahme geworden. Es existiert der Grundsatz der Planerhaltung. Diese Ausnahme vom Nichtigkeitsdogma ist zulässig, da der parlamentarische Gesetzgeber dies selbst angeordnet hat.
In der Fallbearbeitungmüssen Sie daher
| 1. |
den Bebauungsplan zunächst auf Verfahrensfehler untersuchen und auf die Folge der Rechtswidrigkeit hinweisen und dann |
| 2. |
auf die Heilungs- und (Un-)Beachtlichkeitsvorschriften der §§ 214, 215 BauGB und die Möglichkeit eines planergänzenden Verfahrens nach § 214 Abs. 4 BauGB eingehen. |
b) Organkompetenz, § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB i.V.m. § 24 Abs. 1 S. 1 GemO
115
Im Rahmen der Organkompetenzist zu prüfen, welches Organ innerhalb der Gemeindefür die Aufstellung eines Bebauungsplanes zuständig ist. § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB legt bundesrechtlich nicht fest, welches Gemeindeorgan tätig werden muss. Die innergemeindliche Kompetenzverteilung richtet sich daher nach dem Kommunalrecht.[3]
Gemäß § 24 Abs. 1 S. 1 GemOist der Gemeinderatdas Hauptorgan der Gemeinde. Er hat daher alle wesentlichen Gemeindeangelegenheitenzu beschließen.[4] Der Gemeinderat kann grundsätzlich Aufgaben auf beschließende Ausschüsse i.S.d. § 39 Abs. 1 S. 1 GemO oder auf den Bürgermeister, vgl. § 44 Abs. 2 S. 1 GemO, übertragen. Dies gilt jedoch nicht für den in § 39 Abs. 2 GemO festgelegten Aufgabenkatalog,[5] da der Gesetzgeber durch diese Regelung zum Ausdruck gebracht hat, dass es sich dabei um wesentliche vom Gemeinderat zu regelnde Angelegenheiten handelt. Eine Übertragungauf einen beschließenden Ausschussist für die Beschlussfassung über den Erlass von Satzungengemäß § 39 Abs. 2 Nr. 3 GemO und damit auch für den gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossenen Bebauungsplan ausgeschlossen. Aus diesem Grund ist auch eine Übertragung auf den Bürgermeister unzulässig.[6]
Aus § 39 Abs. 2 Nr. 3 GemO kann ferner geschlossen, dass es sich um eine vom Gemeinderat zu treffende Grundsatzentscheidungund damit nichtum ein Geschäft der laufenden Verwaltunghandelt für das der Bürgermeister gemäß § 44 Abs. 2 S. 1 GemO zuständig wäre.
JURIQ-Klausurtipp
Die Auflistung in § 39 Abs. 1 GemOkann nicht nur im Baurecht als Auslegungshilfezur Beurteilung der Frage, ob es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltungi.S.d. § 44 Abs. 2 S. 1 GemO handelt herangezogen werden.[7] Ist eine Auflistung der Angelegenheit gegeben, so handelt es sich um eine gemeindliche Grundsatzentscheidung für die der Gemeinderat gemäß § 24 Abs. 1 S. 2 GemO zuständig ist.
Somit handelt es sich der Aufstellung eines Bebauungsplans weder um ein Geschäft der laufenden Verwaltung, noch ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes dem Bürgermeister durch den Gemeinderat übertragbar, so dass dieser nicht gemäß § 44 Abs. 2 S. 1 GemO zuständig ist. Es bleibt also gemäß § 24 Abs. 1 S. 2 GemO bei der Grundsatzzuständigkeit des Gemeinderats (Organkompetenz).[8]
Wird der Bebauungsplan durch einen unzuständigen Verwaltungsträgererlassen, so ist dieser nichtig. Heilungsvorschriften sind nicht einschlägig: Eine Heilung nach §§ 214, 215 BauGB kommt nicht in Betracht, da es sich zum einen um eine Zuständigkeits- und nicht um eine Verfahrens- oder Formregelung und zum zweiten nicht um eine Vorschrift nach dem BauGB (vgl. den Wortlaut des § 214 Abs. 1 BauGB: „nach diesem Gesetzbuch“) handelt. Auch eine Heilung nach § 4 Abs. 4 S. 1 GemO scheidet aus, da es sich wiederum nicht um eine Verfahrens- oder Formschrift handelt. Fehlerfolgen:[9] Ein Verstoß gegen die Zuständigkeitsvorschriften führt daher zur Nichtigkeit des Plans.
Das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes läuft wie folgt ab:
a) Planaufstellungsbeschluss
116
Lesen Sie § 1 DVOGemO, der die Formen der öffentlichen Bekanntmachung regelt.
Das Verfahren beginnt mit dem Beschluss des Gemeinderates einen Bebauungsplan aufzustellen ( Planaufstellungsbeschluss). Aus Gründen der rechtsstaatlichen Bestimmtheit ist der Planbereichzu benennen.[10] Da der Inhalt des Bebauungsplanes erst nach Durchführung des dem Planaufstellungsbeschluss nachfolgenden Planungsverfahrens festgelegt ist, muss der Planaufstellungsbeschluss keine Aussagen über den zukünftigen Inhalt enthalten.[11] Dieser Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.
117

Fehlerfolgen: Das BauGB beschränkt sich darauf, den Planaufstellungsbeschluss nur zu erwähnen(vgl. § 2 Abs. 1 S. 1 BauGB) oder Folgemaßnahmen von ihm abhängig zu machen. Derartige Folgemaßnahmensind z.B. die Veränderungssperre gemäß § 14 BauGB oder eine Zurückstellung von Baugesuchen gemäß § 15 BauGB (s.u. Rn. 241 ff.). Ein Beschluss vor der Auslegung nach § 3 BauGB wird vom BauGB nicht gefordert. Das Fehleneines Planaufstellungsbeschlusses stellt daher keine Wirksamkeitsvoraussetzungdar.[12] Im Übrigen ist ein Verfahrensverstoß unbeachtlich, da in § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BauGB der Planaufstellungsbeschluss nicht genannt ist.
Hinweis
Für den Bürgerlöst der Planaufstellungsbeschluss keine Wirkungenaus. An ihn können die o.g. Folgemaßnahmen geknüpft werden.
Читать дальше