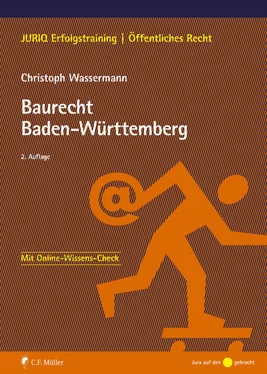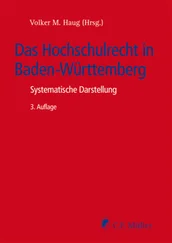1 ...7 8 9 11 12 13 ...34 31
Herrschendwird dies verneint.[11] Lediglich obligatorisch Berechtigte seien nicht geschützt.
Hierfür wird angeführt, dass das Baurecht grundstücks- und nicht personenbezogensei. Es werden die oben dargestellten Argumente ( Rn. 27) vorgebracht.
Ein lediglich obligatorisch Berechtigter müsse hingegen seine Rechtsposition gegenüber dem Eigentümer geltend machen.[12] Könnte ein Mieter oder Pächter eine Verletzung bauplanungsrechtlicher Vorschriften gegenüber Dritten selbständig beispielsweise auch dann geltend machen, wenn der Eigentümer dies nicht will, so würde er damit in den Interessenausgleich der unmittelbar berechtigten Grundstückseigentümer einwirken.
In das Miet- bzw. Pachtrecht werde ebenso wenig eingegriffen, wie in das aus dem Miet- oder Pachtverhältnis folgende Besitzrecht.[13]
Es bestehe auch deshalb kein Bedürfnisfür den baurechtlichen Schutz von obligatorisch Berechtigten, weil diese Gefährdungen von Leben und Gesundheit gestützt auf ihr Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 GG mit einer Nachbarklage abwehren können.[14]
Die Rechtsprechungdes Bundesverfassungsgerichts stehe dem nicht entgegen, da in der von der a.A. herangezogenen Entscheidung nur auf die enteignungsrechtlichen Vorwirkung, die der Planfeststellungsbeschluss auch hinsichtlich dieses obligatorischen Rechts am Grundstück entfaltet, abgestellt werde.[15]
JURIQ-Klausurtipp
Sollte in dem von Ihnen zu bearbeitenden Fall ein Mieter oder Pächter involviert sein, so müssen sie dieses Problem darstellen.
[1]
BVerwG NJW 1989, 2766, 2767 m.w.N.
[2]
Bayerischer VGH BayVBl 2004, 664.
[3]
BVerwG NJW 1989, 2766, 2767 m.w.N.
[4]
BVerwG NJW 1989, 2766, 2767 m.w.N.
[5]
Determann UPR 1995, 215; Thews NVwZ 1995, 224.
[6]
BVerfGE 89, 1.
[7]
Determann UPR 1995, 215.
[8]
V. Mutius GS Sonnenschein, 69, 95
[9]
Determann UPR 1995, 215.
[10]
Determann UPR 1995, 215.
[11]
BVerwG NVwZ 1998, 956; Muckel JuS 2000, 132, 137; Ortloff NVwZ 1999, 955,.
[12]
BVerwG NJW 1989, 2766 m.w.N.
[13]
BVerwG NVwZ 1998, 956.
[14]
BVerwG NJW 1989, 2766 m.w.N.
[15]
BVerwG NVwZ 1998, 956.
2. Teil Grundlagen des öffentlichen Baurechts› E. Bestandsschutz
Hinweis
Fragen des Bestandsschutzes haben insbesondere bei der Beurteilung der baurechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich Bedeutung (Rn. 381 ff.). Bestandsschutz wird jedoch auch im Bereich der präventiven (s. Rn. 419 ff.) und der repressiven Bauüberwachung (s. Rn. 437 ff.) relevant.
2. Teil Grundlagen des öffentlichen Baurechts› E. Bestandsschutz› I. Der Begriff des (baurechtlichen) Bestandsschutzes
I. Der Begriff des (baurechtlichen) Bestandsschutzes
32
Wegen der Eigentumsfreiheitdes Art. 14 Abs. 1 GG kommt dem Bauherren nicht nur die Baufreiheit (s. Rn. 20), sondern als deren weiterer Bestandteil auch der Bestandsschutz zu.
33
In allgemeiner Hinsichtwird unter Bestandsschutzdie Frage angesprochen, ob und unter welchen Voraussetzungen eine bestimmte vorteilhafte Rechtsposition auch in Zukunft aufrechterhalten bleiben kann, obwohl sich die äußeren Umstände verändert haben.[1] Das Institut des Bestandsschutzes zielt also darauf ab, etwas tatsächlich Vorhandenesgegen Eingriffe zu schützen.[2] Dieser Schutz kommt bestehenden Rechten bzw. sonstigen Positionen zu. Eingriffe können auch in den Anforderungen veränderter öffentlich-rechtlicher Normen liegen.[3] Wegen des Schutzes durch den Bestandsschutz soll der vorhandene Bestand nicht nur erhalten, sondern auch weiterhin genutzt werden dürfen.[4]
Hinweis
Die Reichweitedes Bestandschutzes kann in den einzelnen Rechtsgebieten vom Gesetzgeber unterschiedlich ausgestaltet sein. So gelten z.B. im Immissionsrecht u.a. wegen der dynamischen Betreiberpflichten nach § 5 Abs. 1 BImSchG[5] andere Bestandsschutzregeln als im Baurecht. Maßgeblich für die gesetzliche Ausgestaltung des Bestandsschutzes ist zum einen die Schutzwürdigkeit des Bestandes und zum anderen die Schutzwürdigkeit des vom Bestandsschutz Betroffenen.[6]
34
Der baurechtliche Bestandsschutzumfasst grundsätzlich das Recht, dass eine bauliche Anlage, die seinerzeit formell und bzw. oder materiell rechtmäßig errichtet worden ist, erhalten und weiter genutzt werden darf. Dies gilt auch dann, wenn die Anlage wegen einer Änderung der Rechtslage nicht mehr neu errichtet werden dürfte.[7] Die Anlage ist aufgrund des Bestandsschutzes hierdurch vor bauaufsichtlichen Maßnahmen (s.u. Rn. 510 ff.) geschützt, die wegen einer Änderung der Rechtslage ergehen dürften. Baurechtlicher Bestandsschutz ist gegeben, wenn und weil eine schutzwürdige und materiell legale Eigentumsausübungvorliegt.[8]
2. Teil Grundlagen des öffentlichen Baurechts› E. Bestandsschutz› II. Die zwei Arten des baurechtlichen Bestandsschutzes
II. Die zwei Arten des baurechtlichen Bestandsschutzes
35
Es existieren zwei Artendes baurechtlichen Bestandsschutzes, der aktive und der passive Bestandsschutz.[9]
1. Passiver Bestandsschutz
36
Die passive, d.h. abwehrende, Funktionbesteht darin, dass das Recht gewährt wird, den vorhandenen baulichen Bestand in seiner geschützten Form ungestört nutzten zu können.[10] Passiver Bestandsschutz ist primär ein Bestandsnutzungsschutz.[11] Dies bedeutet, dass das bereits Vorhandene geschützt wird. Bauaufsichtliche Maßnahmen dürfen daher nicht ergehen. Ein Anspruch auf Genehmigung einer vormals materiell legalen Anlage besteht ebenso wenig, wie ein Anspruch auf Änderung einer ausgeübten Nutzung bzw. auf eine Erweiterung oder einen Ersatzbau.
2. Aktiver Bestandsschutz
37
Durch den aktiven Bestandsschutzkann dem Eigentümer das Recht zukommen, eine vormals baurechtlich legale bauliche Anlage auch nach Eintritt der Änderung der Rechtslage in ihrer Nutzung zu ändern, sie zu erweiternbzw. einen Ersatzbauzu errichten.[12]
2. Teil Grundlagen des öffentlichen Baurechts› E. Bestandsschutz› III. Grundlagen des Bestandsschutzes
III. Grundlagen des Bestandsschutzes
38
Das Institut des Bestandsschutzes wurde ursprünglich vom Bundesverfassungsgericht aus der Eigentumsgarantiedes Art. 14 Abs. 1 GG entwickelt.[13] Der Grund für die Entwicklung wurde darin gesehen, dass vom Eigentumsschutz maßgeblich der Bestandsschutz umfasst ist. Eine bauliche Anlage, die in der Vergangenheit dem materiellen Recht entsprach, genießt daher den Schutz durch Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG, da sie nicht im Widerspruch zu der gesetzlichen Ausgestaltung von Inhalt und Schranken des Eigentums steht. Im Falle eines Entzugs dieser Rechtsposition sei dann eine Enteignung oder zumindest ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Eigentumsfreiheit gegeben.
Die Ableitung des Bestandsschutzes aus Art. 14 Abs. 1 GG wurde dann jedoch vom Bundesverwaltungsgericht aufgegeben, da sich der Schutzbereich der Eigentumsgarantie aus der Bestimmung des Inhalts und der Schranken ergibt, deren Ausgestaltung gemäß Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG dem Gesetzgeber obliegt.[14] Dies hat zur Folge, dass außerhalb bestehender gesetzlicher Regelungen kein Bestandsschutzexistiert.[15]
Читать дальше