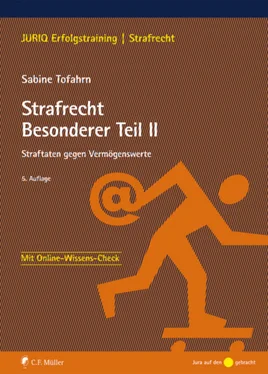Die Zueignung ist rechtswidrig, wenn der Täter keinen fälligen und einredefreien zivilrechtlichen Anspruch auf Übereignung der Sache hat.[82]
88
Die Rechtswidrigkeit hat also nichts mit Rechtfertigungsgründen zu tun, sondern wird rein zivilrechtlichbeurteilt. So hat z.B. der Käufer nach Abschluss des Kaufvertrages und Zahlung des Kaufpreises einen fälligen und einredefreien Anspruch auf Übereignung des gekauften Gegenstands.
Hinweis
Unterscheiden Siedie Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung von der Rechtswidrigkeit der Wegnahme, die nach allgemeinen Rechtfertigungsaspekten beurteilt wird.
89
Obgleich sie ein objektives Tatbestandsmerkmal ist, wird sie aufgrund des Sachzusammenhangs im subjektiven Tatbestand geprüft („objektive Insel im subjektiven Meer“), da Sie zunächst die Zueignungsabsicht geprüft haben müssen.
90
Auf die Rechtswidrigkeit muss sich erneut der Vorsatz des Tätersbeziehen, wobei dolus eventualis ausreicht. Der Täter braucht allerdings Sachverhalts- und Bedeutungskenntnis, da die Rechtswidrigkeit ein normatives Tatbestandsmerkmalist.
91

Bei Gattungsschuldenist die Konkretisierung gem. § 243 Abs. 2 BGB zu beachten: Vor der Konkretisierung richtet sich der Anspruch nur auf Sachen mittlerer Art und Güte, wobei das Auswahlrecht dem Schuldner und nicht dem eventuell eigenmächtig wegnehmenden Gläubiger zusteht. Erst nach der Konkretisierung richtet sich der Anspruch auf eine einzelne Sache. Ob Geld als Gattungsschuldanzusehen ist, ist umstritten.
Beispiel
A schuldet dem B 500 €, weigert sich aber, dem B das Geld zurückzuzahlen. Eines Tages nimmt B aus dem Portemonnaie des A, als dieser gerade beschäftigt ist, fünf 100-Euro-Scheine, wobei er glaubt, aufgrund seines Anspruches gegen B so handeln zu dürfen.
92
Die Rechtsprechungsieht keinen Grund, bei Geld der zivilrechtlichen Wertung zu widersprechen und begreift auch Geld als Gattungsschuld. Allerdings hält sie dem Täter zugute, dass er selbst Geld zumeist nicht als eine Gattungsschuld ansehen und sich dementsprechend bei der Wegnahme irren wird. Diesen Irrtum begreift sie als vorsatzausschließenden Irrtumund löst ihn über § 16 Abs. 1, so dass im Ergebnis eine Strafbarkeit ausscheidet.[83]
93
Die Literaturhat den Begriff der Wertsummenverbindlichkeitgeschaffen. Danach entfällt die Rechtswidrigkeit, wenn der Täter einen Anspruch auf die Wertsumme hat, da es im geschäftlichen Verkehr nur auf die Wertsumme des Geldscheins, nicht aber auf Geldscheine mittlerer Art und Güte ankomme.[84]
Beispiel
Nach Auffassung der Rechtsprechung wäre die beabsichtigte Zueignung also objektiv rechtswidrig gewesen. Da A allerdings glaubte, auf das weggenommene Geld einen Anspruch zu haben, befand er sich in einem Irrtum gem. § 16 Abs. 1 mit der Folge, dass eine Strafbarkeit des A ausscheidet. Auch die Literatur verneint eine Strafbarkeit des A. Allerdings ist ihrer Auffassung nach die Zueignung schon objektiv nicht rechtswidrig.
Anders wäre die Lösung, wenn A wüsste, dass er auf die weggenommenen Scheine keinen Anspruch hat. Die Rechtsprechung würde wegen vollendeten Diebstahls bestrafen, nach der Literatur wäre die Zueignung immer noch nicht rechtswidrig. Da A dies aber glaubte, würde die Literatur hier wegen versuchten Diebstahls bestrafen.
JURIQ-Klausurtipp
Sofern der Täter glaubt, er habe einen Anspruch auf das Geld, wovon für gewöhnlich ausgegangen werden kann, können Sie die Entscheidung des Streits dahingestellt sein lassen, da beide Meinungen im Rahmen des subjektiven Tatbestandes den Diebstahl verneinen. Sie sollten aber das Problem sowie die Lösungsmöglichkeiten aufzeigen und dann darauf verweisen, dass nach beiden Ansichten eine Strafbarkeit nicht in Betracht kommt.
2. Teil Straftaten gegen das Eigentum› B. Diebstahl, § 242› IV. Rechtswidrigkeit und Schuld
IV. Rechtswidrigkeit und Schuld
94
Bei der Rechtswidrigkeit ist zu beachten, dass das Einverstandensein des Gewahrsamsinhabers mit dem Gewahrsamswechsel schon auf Tatbestandsebene bei der „Wegnahme“ zu prüfen ist.
Ansonsten ergeben sich auf dieser Prüfungsebene keine deliktsspezifischen Besonderheiten.
2. Teil Straftaten gegen das Eigentum› B. Diebstahl, § 242› V. Täterschaft und Teilnahme
V. Täterschaft und Teilnahme
95
Die Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme bestimmt sich zunächst nach den allgemeinen Regeln der §§ 25 ff. Aus dem tatbestandsbezogenen Täterbegriff ergibt sich, dass Mittäter oder mittelbarer Täternur sein kann, wer selbst die Zueignungsabsicht aufweist, da ihm Rahmen des § 25 nur die Handlung zugerechnet wird. Dass ein Beteiligter am Diebstahl diese Absicht hat, hat aber umgekehrt nicht zwingend zur Folge, dass er damit auch automatisch Täter ist. Die Täterschaft bestimmt sich vielmehr wie sonst auch nach der Tatherrschaft bzw. dem animus auctoris.
Beispiel
A steht vor der Eingangstüre des Juweliergeschäfts Schmiere, während B drinnen den Tresor leer räumt. Für seine Dienste soll A sich aus der Beute ein Stück aussuchen dürfen.
Hier hat A unstreitig die Absicht, sich das auszusuchende und zuvor von B weggenommene Schmuckstück zuzueignen. Gleichwohl ist A nur Gehilfe gem. § 27, da er weder funktionale Tatherrschaft noch animus auctoris hat.
96
Wiederholen Sie in diesem Zusammenhang Täterschaft und Teilnahme, insbesondere die sukzessive Mittäterschaft und das absichtslos dolose Werkzeug, dargestellt im Skript „Strafrecht AT II“!
Ein Klausurklassiker beim Diebstahl ist die sukzessive Mittäterschaftsowie die sukzessive Beihilfe in Abgrenzung zur Begünstigung gem. § 257. Da beim Diebstahl die Vollendung und Beendigung auseinander fallen, stellt sich die Frage, wie ein Beteiligter zu bestrafen ist, der erst nach Vollendung, aber noch vor Beendigunghinzukommt. Nach Auffassung der Rechtsprechungreicht auch ein Tatbeitrag aus, der in dieser Phase erbracht wird, sofern animus auctoris bejaht werden kann. Die Literaturhingegen lehnt die sukzessive Beihilfe teilweise, die sukzessive Mittäterschaft hingegen überwiegend ab. Da es sich um eine Problematik aus dem „Allgemeinen Teil“ handelt, erfolgt an dieser Stelle nur ein erinnernder Hinweis.
In Zusammenhang mit der mittelbaren Täterschaft kommt eine Tatbegehung durch ein absichtslos, doloses Werkzeugin Betracht, wenn der Vordermann weiß was er tut aber keine Zueignungsabsicht hat. Um diese Fälle erfassen zu können, wurde in der Literatur der „formal-juristische Tatherrschaftsbegriff“ entwickelt

Online-Wissens-Check
Wodurch unterscheidet sich das Eigentum vom Gewahrsam?
Überprüfen Sie jetzt online Ihr Wissen zu den in diesem Abschnitt erarbeiteten Themen.
Unter www.juracademy.de/skripte/login steht Ihnen ein Online-Wissens-Check speziell zu diesem Skript zur Verfügung, den Sie kostenlos nutzen können. Den Zugangscode hierzu finden Sie auf der Codeseite.
2. Teil Straftaten gegen das Eigentum› B. Diebstahl, § 242› VI. Übungsfall Nr. 1
Читать дальше