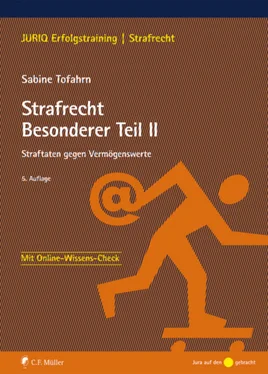In diesem Fall hat A volle Sachverhaltskenntnis. Er glaubt aber irrig, aufgrund des Kaufvertrages bereits Eigentümer geworden zu sein. Damit weiß er nicht, dass die Sache noch fremd ist. Ihm fehlt mithin die Bedeutungskenntnis.
70
Ob der Vorsatzsich hinsichtlich des Tatobjektes während der Tatbegehung verengt, erweitert oder ändert, ist unbeachtlich, sofern er durchgehend fortbesteht.[55] Gibt der Täter hingegen seinen ursprünglichen Vorsatz auf und fasst danach einen neuen Vorsatz, so liegt eine Zäsurvor mit der Folge, dass man von 2 Taten ausgehen muss. Bedeutsam wird dies in der Klausur vor allem in Zusammenhang mit § 243, dazu unter Rn. 111, 145mehr.
Beispiel 1
A steigt nachts in den Juwelierladen des J ein, um eine bestimmte Perlenkette mitzunehmen. Nachdem er sich die Kette allerdings genauer angesehen hat, stellt er fest, dass sie ihm nicht gefällt und nimmt stattdessen einen Brillantring mit.
Beispiel 2
A steigt wiederum in den Juwelierladen ein, um die Perlenkette mitzunehmen. Leider befindet sich in dem Laden an diesem Abend aber nur noch billiger Modeschmuck, weswegen A beschließt, unverrichteter Dinge wieder nach Hause zu gehen. Beim Rausgehen fällt ihm eine Flasche Rotwein auf, die er aus Frust mitnimmt.
In Beispiel 1 liegt ein Diebstahl gem. § 242 am Ring vor. Der Vorsatzwechsel ist unbeachtlich. In Beispiel 2 liegt ein versuchter fehlgeschlagener Diebstahl an der Kette und ein vollendeter Diebstahl am Rotwein vor, da A zwischenzeitlich seinen Vorsatz aufgegeben hatte. Fraglich ist, ob er zur Begehung dieses Diebstahls gem. „§ 243 Abs. 1 Nr. 1“ eingestiegen ist.
71
Nachdem Sie den Vorsatz geprüft haben, müssen Sie sich nun mit der vom Gesetz verlangten Zueignungsabsichtauseinander setzen.

Zueignungsabsichtliegt vor, wenn der Täter die Sache wegnimmt, um sie unter Anmaßung einer eigentümerähnlichen Stellung zumindest vorübergehend der eigenen oder einer dritten Vermögenssphäre einzuverleiben (Aneignungsabsicht)und sie der Verfügungsgewalt des Berechtigten dauerhaft zu entziehen (Enteignungsvorsatz).
Die Zueignungsabsicht besteht also aus 2 Komponenten:
| Enteignungsvorsatz |
Aneignungsabsicht |
| Dauerhafte Verdrängung des Eigentümers |
Zumindest vorübergehende Einverleibung des Sache |
| Dolus eventualis reicht |
Dolus directus 1. Grades erforderlich |
72
Erforderlich ist, dass der Täter bei Vornahme seiner Tathandlung, also der Wegnahme, die Absicht hatte, die Sache sich oder einem Dritten zuzueignen. Liegt die Absicht nur vorher oder erst nachher vor, so ist Diebstahl zu verneinen.
Beispiel
A hat sich überlegt, B eins auszuwischen und ihm das Fahrrad wegzunehmen, um es anschließend zu verkaufen. Als er jedoch damit beginnt, das Schloss aufzubrechen, überlegt er es sich anders und will sich nunmehr das Fahrrad nur für eine Stunde ausleihen. Unterwegs trifft er dann allerdings seinen Cousin C, dem das Fahrrad ausnehmend gut gefällt. Erneut entscheidet A sich um und verkauft dem C das Fahrrad für 100 €.
In dem Augenblick, in dem der Diebstahl in das Versuchsstadium eintrat – Aufbrechen des Schlosses – besaß A keine Zueignungsabsicht mehr, da er das Fahrrad zurückbringen wollte. Dass diese Absicht sowohl vorher als auch nachher gegeben war, ist irrelevant!
Hinweis
Maßgeblicher Beurteilungszeitpunktfür sowohl den Vorsatz als auch die entsprechenden, vom Gesetz verlangten Absichten ist stets der Zeitpunkt der Tat gem. § 8, also jener Zeitpunkt, an welchem „der Täter oder Teilnehmer gehandelt hat oder im Falle des Unterlassens hätte handeln müssen“, wobei es ausreicht, wenn Vorsatz und Absicht im Zeitpunkt des Eintritts der Tat in das Versuchsstadium vorliegen. Behalten Sie diesen Zeitpunkt bei Ihrer Prüfung immer im Auge. Aus diesem Grund ist es auch unabdingbar, dass Sie im Obersatz stets das Verhalten benennen, an welches Sie bei der Prüfung anknüpfen, also z.B.: „A könnte sich wegen Diebstahls gemäß § 242 strafbar gemacht haben, indem er das Schloss aufbrach und das Fahrrad mitnahm.“
73

Lange Zeit war umstritten, worauf sich die Zueignungsabsicht beziehen muss. Nach der heute herrschenden Vereinigungsformel[56] liegt Zueignungsabsicht vor, wenn der Täter in der Absicht handelt, die Sache (ihrer Substanz nach) oder den in ihr verkörperten Sachwertunter Ausschluss des Eigentümers dem eigenen Vermögen einzuverleiben.
JURIQ-Klausurtipp
Eine Auseinandersetzungmit der älteren von der Rechtsprechung damals vertretenen Substanztheorie[57] und der teilweise heute noch vertretenen Sachwerttheorie[58] ist in der Klausur nicht erforderlich.
74
Das Einbeziehen des Sachwerts in die Definition wird bei den problematischen und damit auch klausurrelevanten Fällen bedeutsam, bei denen der Täter eine Sache wegnimmt in der Absicht, sie nach (oder mit) dem Gebrauch wieder an den Eigentümerzurückzugeben.
Beispiel
A nimmt sich das Sparbuch seiner Oma aus der Kommode und hebt damit 10 000 € vom dazugehörigen Sparkonto ab. Unmittelbar danach legt er das Sparbuch, wie von vorne herein geplant, an denselben Ort zurück.

[Bild vergrößern]
75
Stellte man in Fällen dieser Art nur auf die Sachsubstanz ab, müsste man die Zueignungsabsicht verneinen, da der Täter bezüglich der Sachsubstanz den bisherigen Eigentümer nicht aus seiner Eigentümerposition verdrängen möchte. Es würde also am Enteignungsvorsatz fehlen. Die Einbeziehung des Sachwertes hingegen ermöglicht die Bejahung der Zueignungsabsicht.
76
Wir werden uns mit den verschiedenen Fallkonstellationen und der Problematik der Bestimmung des Sachwertesdort näher auseinandersetzen, wo sie hingehört, nämlich beim Enteignungsvorsatz unter Rn. 81. Gleichwohl schon vorab die Lösung des Sparbuchfalles:
Beispiel
Im obigen Fall hat sich der Täter nicht die Substanz der Sache zueignen wollen. Vielmehr hat er sich lediglich der Legitimationswirkung gem. § 808 BGB des Sparbuchs bedient, die den Inhaber als Forderungsberechtigten gegenüber der Bank ausweist und die Bank zur schuldbefreienden Zahlung veranlasst. Würde man nur auf die Substanz der Sache abstellen, so läge kein Diebstahl vor. Erst unter Einbeziehung des Sachwertes kann die Zueignungsabsicht bejaht werden, da das Sparbuch aufgrund der Legitimationswirkung den Wert des Sparguthabens verkörpert und der Täter diesen in dem Sparbuch verkörperten Wert der Sache durch Gebrauch entzogen hat.[59]
Ein Diebstahl an dem ausgezahlten Geld kommt nicht in Betracht, da die Scheine bei Auszahlung übereignet werden. Fraglich ist aber, ob durch Vorlage des Sparbuchs ein Betrug gegenüber dem Mitarbeiter der Bank und zu Lasten Oma O in Betracht kommt. Das hängt maßgeblich davon ab, welche konkludente, täuschende Erklärung in der Vorlage des Sparbuchs zu sehen ist und welchem Irrtum der Bankmitarbeiter unterliegt. Aufgrund der Legitimationswirkung des Sparbuchs, wonach die Bank befreiend leisten kann, wird überwiegend angenommen, dass ein Bankangestellter sich keine Gedanken mache über die Berechtigung des Vorlegenden.[60] Sollte dies anders beurteilt werden, würde der Betrug aber als mitbestrafte Nachtat zurücktreten.
Читать дальше