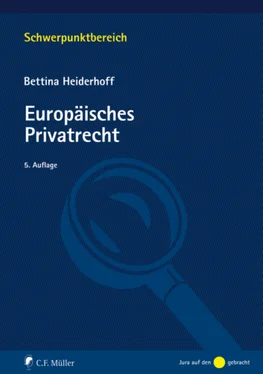1 ...6 7 8 10 11 12 ...43 17
Etwas mehr Probleme stellen sich im Verbrauchervertragsrecht, welches einen großen Teil der privatrechtlichen Richtlinien ausmacht. Vielfach scheint Verbraucherschutz den Handel eher zu erschweren und den Wettbewerb zu beschränken. Leider sind auch die Begründungen in den Erwägungsgründen der älteren Richtlinien gelegentlich so konfus, dass es nicht verwundern kann, wenn immer wieder schon die Kompetenz der EU für bestimmte Regelungen angezweifelt wird.[13] Noch in dem ersten Vorschlag für die neue Verbraucherkredit-RL aus dem Jahr 2002 hieß es gänzlich unklar: „Die Maßnahme hat die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand. Sie trägt zur Erreichung des Zieles bei, die Verbraucher zu schützen, indem sie im Rahmen der Errichtung des Binnenmarkts eine Harmonisierung bewirkt. Aus diesem Grund wurde Art. 95 EG (heute Art. 114 AEUV) als Rechtsgrundlage herangezogen.“[14] Seitdem hat die Kommission jedoch viel dazugelernt. Letztlich ist die Kompetenz der EU gerade für das Verbrauchervertragsrecht nämlich sehr deutlich. Die Begründung dafür, dass Verbraucherschutz der Verbesserung des Binnenmarkts dient, wird folgendermaßen konstruiert: Indem in allen Mitgliedstaaten ein einheitliches Verbraucherrecht mit einem hohen Schutzniveau entsteht, steigt das Vertrauen des Verbrauchers. Er konsumiert verstärkt und schreckt insbesondere nicht mehr vor grenzüberschreitenden Rechtsgeschäften, wie z.B. Einkäufen oder der Kreditaufnahme im Ausland, zurück.[15] Dieser Gedankengang findet sich in allen verbraucherpolitischen Strategie-Papieren[16] und wird ausdrücklich in der Verbraucherkredit-RL aufgegriffen[17]. Auch in der Verbraucherrechte-RL wird ausgeführt, dass die durch unterschiedliche Verbrauchervorschriften entstehende Rechtsunsicherheit das Vertrauen der Verbraucher in den Binnenmarkt einschränkt.[18]
18
Im Beispiel 1will die Kommission das kaufrechtliche Gewährleistungsrecht vollharmonisieren und dazu die Rechtsform der Verordnung wählen. Ob Art. 114 AEUV als Kompetenzgrundlage für eine solche Maßnahme ausreichen würde, ist in den letzten Jahren viel diskutiert worden. Denn die Kommission hatte tatsächlich ein europäisches Kaufrecht (kurz GEK für „gemeinsames europäisches Kaufrecht“ oder CESL für „common European sales law“) geplant, das auf Art. 114 AEUV gestützt werden sollte.[19] Beim GEK regte sich gegen die Verwendung des Art. 114 AEUV starker Widerstand. Das hatte seinen Grund aber vor allem darin, dass das GEK als ein „28. Regime“ neben die verschiedenen in den Mitgliedstaaten geltenden Kaufrechte treten sollte. Ein solches zusätzliches Parallelrecht, so wurde meist vertreten, sei gar keine Angleichungsmaßnahme.[20] Die Pläne für das GEK sind inzwischen auf politischer Ebene gescheitert (dazu näher unten Rn. 637). Es wird aber weitere Ansätze geben und die Kompetenzfrage bleibt spannend. Im Beispiel will die Kommission das Kaufrecht in der EU angleichen, so dass die beim GEK geäußerten Bedenken entfallen. In Bezug auf die inzwischen erlassene Warenkauf-RL, die in ihrem Erwägungsgrund 2 neben Art. 114 auch Art. 26 Abs. 1 und 2 sowie Art. 169 Abs. 1 und 2 AEUV als Kompetenzgrundlagen benennt, ist über die Frage der Kompetenz überhaupt nicht gestritten worden, obwohl sie vollharmonisierend angelegt ist.
Die Besonderheit in dem Fallbeispiel besteht darin, dass nicht mithilfe einer Richtlinie ein Mindeststandard bestimmt wird, den alle Mitgliedstaaten in ihre Rechtsordnung integrieren sollen, sondern dass eine Vollharmonisierung durch eine Verordnung geplant ist. Die sich dabei ergebenden Bedenken werden im Folgenden näher erörtert.
3. Subsidiaritätsprinzip und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als Kompetenzschranken
19
Die Zuständigkeit der EU für die Rechtssetzung ist nur selten eine ausschließliche. Zumeist konkurriert sie mit der weiter bestehenden Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.[21] Die EU und die Mitgliedstaaten dürfen also grundsätzlich gleichermaßen rechtssetzendtätig werden. Im Bereich dieser konkurrierenden Rechtssetzungskompetenz wird die Zuständigkeit der EU durch das in Art. 5 Abs. 3 EUV verankerte Subsidiaritätsprinzip begrenzt.[22] Danach reicht die Zuständigkeit der EU nur soweit, wie die zu verwirklichenden Ziele auf nationaler Ebene nicht ausreichend erreicht werden können.[23] Außerdem ist die Union nach Art. 5 Abs. 4 EUV an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebunden und muss daher zusätzlich stets das mildeste Mittel zur Erreichung ihres Ziels wählen.[24]
b) Rechtsangleichung und Subsidiaritätsprinzip
aa) Geltung des Subsidiaritätsgrundsatzes im Rahmen des Art. 114 AEUV
20
Gelegentlich ist behauptet worden, die Rechtsangleichungskompetenz im Sinne des Art. 114 AEUV sei eine ausschließliche Kompetenz der EU. Das beruht darauf, dass die Angleichung von Recht zwischen den Mitgliedstaaten – gleichsam aus der Natur der Sache heraus – ausschließlich von der EU und nicht von den Einzelstaaten erreicht werden kann.[25] In diesem Fall würde sich das Subsidiaritätsprinzip von vornherein nicht auf die aus Art. 114 Abs. 1 AEUV folgende Rechtssetzungskompetenz der EU auswirken. Die herrschende, auch von der Kommission selbst[26] und vom EuGH vertretene Gegenauffassung geht demgegenüber im Ansatz davon aus, dass Art. 114 AEUV nicht zu den wenigen ausschließlichen Kompetenzender EU gehört. Damit unterliegt sie also dem Subsidiaritätsgrundsatz.[27] Obwohl diese Ansicht einräumen muss, dass die Angleichung des Rechts der Mitgliedstaaten im Allgemeinen nicht von den einzelnen Mitgliedstaaten durchgeführt werden kann, führt dies zu gewissen praktischen Unterschieden. Diese ergeben sich zum einen, wenn es um Regelungen von Details in den Richtlinien geht.[28] Insbesondere aber ist die Unterscheidung wichtig, wenn es darum geht, ob der Grundsatz der Minimalharmonisierung (Mindeststandardprinzip) aufgegeben werden darf.
bb) Mindeststandardgrundsatz
21
Fast alle früheren Richtlinien zum Verbrauchervertragsrecht folgten dem Mindeststandardgrundsatz. Der Mindeststandardgrundsatz bedeutet, dass den Mitgliedstaaten die Freiheit eingeräumt wird, im nationalen Recht einen höheren Schutzstandard vorzusehen, als die Richtlinie es zwingend vorschreibt. Eine Pflicht für die Union als Richtliniengeber, den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu belassen, eine Partei stärker zu schützen als die Richtlinie dies vorsieht, ergibt sich nicht aus dem Charakter der Richtlinie als solcher. Denn Art. 288 S. 3 AEUV überlässt „die Wahl der Form und der Mittel“ den Mitgliedstaaten. Ein inhaltlicher Spielraum ist dort nicht vorgesehen.
Meist wird der Mindeststandardgrundsatz aus dem Subsidiaritätsprinzip abgeleitet.[29] Daraus kann man aber nicht den Schluss ziehen, dass alle Richtlinien an dem Mindeststandardgrundsatz festhalten müssen. Das Subsidiaritätsprinzip zwingt nämlich nicht in jedem Fall zu einer solchen Öffnung. Wenn gerade die wirklich, also auch nach oben hin, einheitliche Regelung eines Sachverhalts nötig ist, dann können die Mitgliedstaaten insofern keine Restkompetenz behalten und aus dem Subsidiaritätsprinzip kann kein Regelungsfreiraum für die Mitgliedstaaten abgeleitet werden.
Der Mindeststandardgrundsatz hat allerdings wohl noch eine zweite Wurzel: Er begründet sich auch aus der inhaltlichen Zielsetzungder Richtlinien. Durch diese soll (meist) ein möglichst hohes Schutzniveau erreicht werden, und damit steht es im Widerspruch, wenn einige Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinien ihren nationalen (Verbraucher-)Schutzstandard senken müssen.[30] Das gilt gerade für die Richtlinien, die auf Art. 114 AEUV gestützt sind. Denn dort wird verlangt, dass ein hohes Schutzniveau gewährt wird, was mit einer Absenkung des Standards auch nur in einzelnen Mitgliedstaaten kaum vereinbar ist.
Читать дальше