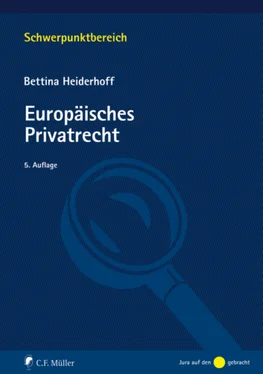Im zweiten Teil ( § 4und § 5) wird ein Überblick über die Inhalte des existierenden EU-Privatrechts gegeben. Dabei erfolgt eine Beschränkung auf den Bereich des allgemeinen Privatrechts. Das Arbeits-, Gesellschafts- und Wettbewerbsrecht, das Bank- und Kapitalmarktrecht, das Urheber- und Markenrecht, das Agrar- und Beihilferecht der EU sind nicht aufgenommen worden. Diese Rechtsgebiete sind auf europäischer Ebene teilweise bereits deutlich weiterentwickelt und nehmen mehr Raum ein, als das allgemeine EU-Privatrecht. Daher muss ihre Darstellung der Spezialliteratur vorbehalten bleiben. In diesem zweiten Teil ist der Blick auf die Auswirkungen des EU-Rechts auf die konkrete Rechtsanwendung gerichtet. Es geht also darum, das deutsche Recht im Lichte des EU-Rechts zu begreifen. Dazu werden zunächst allgemeine, immer wieder verwendbare Grundgedanken des EU-Privatrechts vorgestellt.
Sodann werden in einem dritten Teil ( § 6) die wichtigsten Einzelfragen des EU-Privatrechts in der dem BGB entsprechenden Reihenfolge angesprochen. Angefangen beim Vertragsschluss bis zu einzelnen sachenrechtlichen Fragen und schließlich zum IPR werden verschiedene konkrete Problembereiche und Regelungsschwerpunkte dargelegt, wobei immer auf die Argumentationsstrukturen geachtet wird.
Im vierten Teil ( § 7) wird das Projekt eines europäischen Vertragsgesetzbuchs näher vorgestellt.
§ 1 Vorüberlegungen› C. Informationsquellen zum EU-Privatrecht
C. Informationsquellen zum EU-Privatrecht
§ 1 Vorüberlegungen› C. Informationsquellen zum EU-Privatrecht › I. Informationen in diesem Buch
I. Informationen in diesem Buch
3
Um die vertiefte Auseinandersetzung mit den angesprochenen Fragen zu ermöglichen, enthält das vorliegende Werk mehr Fußnotenverweise, als es für ein Lehrbuch üblich ist. Neben den Primärquellen und der wichtigsten Rechtsprechung werden teils auch ausgewählte vertiefende Aufsätze oder sogar Monographien angegeben.
Zudem befindet sich im Anhang I des Buchs eine Liste der wichtigsten Richtlinien mit kurzen Zusammenfassungen des Inhalts sowie der wesentlichen dazu ergangenen Urteile des EuGH. Im Anhang II sind die wesentlichen privatrechtlichen Verordnungen aufgelistet. Anhang III erläutert zentrale Fachbegriffe, die im Prozess der (möglichen) Entstehung eines europäischen Vertragsrechts bedeutsam sind.
§ 1 Vorüberlegungen› C. Informationsquellen zum EU-Privatrecht › II. Weitere wichtige Quellen
II. Weitere wichtige Quellen
4
Die europäischen Richtlinien sind inzwischen recht leicht zugänglich. In Großkommentaren sind sie vielfach mit abgedruckt und es gibt verschiedene Textsammlungen. Eine übersichtliche Darstellung bietet die „Textsammlung Europäisches Privatrecht“, Hrsg. Grundmann/Riesenhuber, 3. Aufl. de Gruyter 2019. Auch auf nichtstaatliche Normkataloge ausgerichtet ist der Band „Europäisches Privatrecht – Basistexte“, Hrsg. Schulze/Zimmermann, 5. Aufl. Nomos 2016.
2. Rechtsprechung des EuGH
5
Für das EU-Recht sind die Entscheidungen des EuGH, der das Auslegungsmonopol hat und auch Rechtsfortbildung betreibt, von großer Bedeutung. Die Entscheidungen sind mithilfe einer komfortablen Suchmaske auf der Seite des EuGH ( https://curia.europa.eu) abrufbar.
3. Lehrbücher und Kommentare
6
Es gibt einige Bücher zum EU-Privatrecht, die sich besonders an Studierende richten. Zur Vertiefung sind vor allem zu nennen: Riesenhuber, „Europäische Methodenlehre“, 3. Aufl. de Gruyter 2015 sowie der von Langenbucher herausgegebene Band „Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht“, 4. Aufl. Nomos 2017. Ein Kurzlehrbuch zum privaten Vertragsrecht der EU ist Riesenhuber, „EU-Vertragsrecht“, Mohr Siebeck 2013. Einen etwas anderen Gegenstand hat das Werk Schulze/Zoll, „Europäisches Vertragsrecht“, 2. Aufl. Nomos 2017, das sich hauptsächlich mit den im Vertragsrecht der EU, und dort vor allem im GEK (Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht) und im Acquis Communautaire bestehenden Prinzipien und Leitgedanken befasst. Eine Kommentierung aller relevanten Normen des europäischen Vertragsrechts bietet das Werk „Commentaries on European Contract Laws“, Hrsg. Jansen/Zimmermann, Oxford University Press 2018. Für 2020 ist zudem das Werk Gebauer/Wiedmann, „Europäisches Zivilrecht“, 3. Aufl. C.H. Beck, angekündigt, welches ebenfalls Kommentierungen zu den EU-Richtlinien und Verordnungen enthält.
Ein riesiges, enzyklopädisches Werk ist das von Basedow/Hopt/Zimmermann herausgegebene „Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts“, Mohr Siebeck 2009. Es ist in Stichwörter gegliedert und erfasst rechtsvergleichende sowie EU-rechtliche Fragen.
Rechtsvergleichend richten sich an Studierende die Werke von Alpa/Andenas, „Grundlagen des Europäischen Privatrechts“, Springer 2010; Kötz, „Europäisches Vertragsrecht“, 2. Aufl. Mohr Siebeck 2015; sowie Ranieri, „Europäisches Obligationenrecht“, 3. Aufl. Springer 2009.
4. Weiterführende Informationen im Internet
7
Die EU betreibt mehrere Seiten im Internet. Auf der Hauptseite https://europa.euwerden umfassende Informationen – auch zu Rechtssetzungsvorhaben – in bürgernaher Form zur Verfügung gestellt. Dort sind aber auch alle Richtlinientexte und sogar die Entwürfe und Materialien zu finden. Die offizielle Seite für alle rechtlichen Informationen ist https://eur-lex.europa.eu, wo vor allem dann gute Suchmöglichkeiten bestehen, wenn man die Dokumentnummer kennt.
Das nationale Recht der Mitgliedstaaten ist Gegenstand der Seite https://n-lex.europa.eu.
Empfehlenswert sind einige hervorragende, stets aktuelle Informationsseiten, die von deutschen Wissenschaftlern betreut werden, wie z.B. die Seite von Prof. Dr. Oliver Remien, Universität Würzburg ( https://www.jura.uni-wuerzburg.de/lehrstuehle/remien/europaeisches_privatrecht/).
§ 2 Überblick über das bestehende Privatrecht der EU
Inhaltsverzeichnis
A. Privatrecht im primären EU-Recht
B. Privatrecht im sekundären EU-Recht
§ 2 Überblick über das bestehende Privatrecht der EU› A. Privatrecht im primären EU-Recht
A. Privatrecht im primären EU-Recht
8
Mit dem Begriff Europarecht wird in aller Regel zunächst öffentliches Recht assoziiert. Tatsächlich besteht das Europarecht zu einem sehr großen Anteil aus öffentlich-rechtlichen Normen. Der öffentlich-rechtliche Charakter ist jedoch kein Muss. Das Europarecht findet seine Identität vielmehr darin, dass es das – entweder von den Organen der EU oder auch von den Mitgliedstaaten gemeinsam geschaffene – Recht der Europäischen Union ist. Es enthält sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Normen. Dabei ist das Europarecht nach herrschender Ansicht eine Rechtsordnung sui generis, also weder Völkerrecht noch nationales Recht.[1] Der Vertrag von Lissabon stellt mehr dar als einen bloßen Staatsvertrag.[2] Das gesamte EU-Recht hat Anwendungsvorrangvor dem nationalen Recht (näher dazu auch Rn. 31 ff.).[3]
Das in den so genannten Gründungsverträgen der EU und in den sonstigen unmittelbar zwischen den Mitgliedstaaten abgeschlossenen Verträgen enthaltene Recht wird als primäres EU-Rechtbezeichnet.[4] Gerade hier findet sich ganz überwiegend öffentliches Recht. Aber im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) selbst sind auch einige privatrechtliche oder wenigstens für den Privatrechtsverkehr unmittelbar relevante Normen enthalten. So enthalten die wettbewerbs- und kartellrechtlichen Vorschriften in den Art. 101 ff. AEUV privatrechtliche Elemente. Ohnehin richten sie sich nicht an die Mitgliedstaaten, sondern an die Unternehmen. Zumeist enthalten sie allerdings hoheitliche Verbote. Privatrechtlichen Charakter trägt Art. 101 Abs. 2 AEUV, der die Nichtigkeit verbotener Vereinbarungen bestimmt. Viele weitere Normen sind zwar nicht privatrechtlicher Art, betreffen aber dennoch unmittelbar den Rechtsverkehr Privater. So ist es mit den Grundfreiheiten (dazu unten Rn. 45 ff.) und Diskriminierungsverboten (dazu unten Rn. 49).
Читать дальше