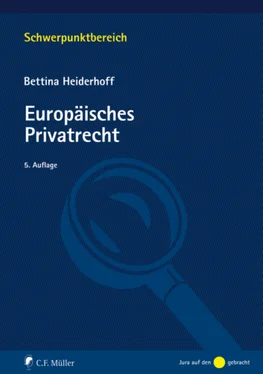ff) Sonderfall: Rückabwicklung bei Beteiligung an einem Immobilienfonds
VI.Die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in den Vertrag
1. Einbeziehung von AGB nach der Klausel-RL
2. Einbeziehung von AGB im Fernabsatz und E-Commerce
3. Sonderfall: Einbeziehung von AGB bei Internetauktionen
VII. Sonderfall: Die Regelung über unbestellt zugesandte Leistungen und ihre Umsetzung in Deutschland
1. Regelung in der Fernabsatz- und der Verbraucherrechte-RL
2.Die Reichweite des § 241a BGB vor dem Hintergrund der Richtlinienvorgaben
a) Möglichkeit der konkludenten Annahme
b) Gesetzliche Ansprüche
B. Allgemeine Regelungen zum Inhalt von Verträgen
I. Die Inhaltskontrolle nach der Klausel-RL
1. Grundlagen
2. Ziele der Klausel-RL
3.Erfasste Klauseln
a) Kontrolle kurzer und klarer Vertragsbedingungen
b) Notarielle Verträge als Klauseln im Sinne der Richtlinie
c) Vom nationalen Gesetzgeber geschaffene Vertragsbedingungen
4.Der unionsrechtliche Maßstab von Treu und Glauben nach Art. 3 Klausel-RL
a) Treuwidriges Abweichen vom dispositiven Recht
b) Eigenständiger europäischer Maßstab von Treu und Glauben
c) Der Anhang zu Art. 3 Klausel-RL
5. Der Maßstab des Art. 5 Klausel-RL – Transparenz
6. Rechtsfolgen der Nichtigkeit von AGB
II. Klauselverbote in anderen Richtlinien
C. Besondere Vertragsarten im EU-Privatrecht
I. Einführung
II. Der Verbraucherkreditvertrag
1. Entstehungsgeschichte und Ziele der Verbraucherkredit-RL
2. Strategie der Vollharmonisierung
3.Der Verbraucherkreditvertrag
a) Begriff und erfasste Verträge
b) Sonderprobleme: Vollmacht, Bürgschaft und Schuldbeitritt durch einen Verbraucher
III.Der Verbrauchsgüterkaufvertrag
1. Entstehungsgeschichte und Ziele der Verbrauchsgüterkauf-RL
2. Der Verbrauchsgüterkaufvertrag
IV.Der Pauschalreisevertrag
1. Ziele der Pauschalreise-RL
2. Der Pauschalreisevertrag
V. Der Zahlungsdienstevertrag
1. Ziele der Zahlungsdienste-RL I und II
2. Der Zahlungsdienstevertrag
VI.Der Teilzeitnutzungsrechtevertrag
1. Ziele der Teilzeitnutzungsrechte-RL
2. Der Teilzeitnutzungsrechtevertrag
D. EU-Vorschriften zur vertraglichen Haftung
I. Übertragung des Rechtsfolgenbereichs in den Umsetzungsspielraum der Mitgliedstaaten
II.Haftung bei der Verletzung von Informationspflichten
1. Schadensersatzpflicht als Folge von Informationspflichtverletzungen
2. Informationspflichtverletzung als Pflichtverletzung i.S.d. § 280 Abs. 1 BGB
3. Kausal verursachter Schaden
III. Haftung bei der Verletzung von Gleichbehandlungspflichten
IV.Leistungsfristen und Verzug
1. Überblick: Vorschriften zu Leistungsfristen und Verzug im EU-Privatrecht
2. Lieferfristen in der Verbraucherrechte-RL
a) Überblick
b) Entbehrlichkeit der Fristsetzung über § 323 Abs. 2 Nr. 3 BGB hinaus
c) Pflicht zur unverzüglichen Lieferung nach § 475 Abs. 1 BGB
3. Geltungsbereich und wesentliche Elemente der Zahlungsverzugs-RL
4.Umsetzung der Zahlungsverzugs-RL
a) Geringe Abweichung vom nationalen Recht
b) Der Begriff „verantwortlich“
c) Verzugseintritt bei Banküberweisung
V. Mängelhaftung beim Warenkauf
1. Grundlagen
2.Begriff der Vertragsmäßigkeit
a) Vorüberlegung
b) „Vernünftige“ Erwartungen
c)Vereinbarungen und Beschaffenheit
aa) Beschreibung gleich Vereinbarung?
bb) Negativvereinbarungen
cc) Begriff der Beschaffenheit
d) Erwartungen des Käufers und Vertragsmäßigkeit
e) Die Regelung des Art. 2 Abs. 3 Verbrauchsgüterkauf-RL (§ 442 BGB)
3.Weitere Einzelfragen zur Mängelhaftung nach dem Verbrauchsgüterkaufrecht
a) Erheblichkeit des Mangels
b) Beweislast für das Vorliegen des Mangels bei Gefahrübergang
c) Erfordernis der Fristsetzung durch den Verbraucher
d) Minderung nach Nacherfüllung und Rücktritt nach Minderung?
e) Wertersatz für die erfolgte Nutzung der Ware bei Ersatzlieferung
f) Ersatzlieferung beim Stückkauf
g) Umfang und Erfüllungsort der Nacherfüllung
aa) Der Aus- und Wiedereinbau
bb) Die Unverhältnismäßigkeit der Nacherfüllung
cc) Erfüllungsort der Nacherfüllung
h) Verjährung
i) Die Regresskette bei Gebrauchtwaren
j) Zwingende Geltung oder Abweichungen „zugunsten des Verbrauchers“?
VI.Haftung bei Pauschalreisen
1. Die Haftungstatbestände in der Pauschalreise-RL
2. Die Umsetzung der Haftungstatbestände
3. Der Umfang der Ersatzpflicht
VII.Die Haftung im Zahlungsdienstevertrag
1. Haftung des Zahlungsinstituts
2. Haftung bei missbräuchlicher Nutzung eines Zahlungsinstruments
E. EU-Vorschriften zur außervertraglichen Haftung
I. Produkthaftung
1. Die Produkthaftungs-RL
2.Für die Auslegung des nationalen Rechts wichtige Inhalte der Richtlinie
a) Fehler
b) Haftungsausfüllende Kausalität
c) Schadensbegriff
d) Umfang der Haftung
aa) Sich ausbreitende Sachschäden – die sog. Weiterfresserschäden
bb) Selbstbeteiligung
cc) Haftungshöchstgrenze
II.Verantwortlichkeit des Diensteanbieters und des Datenverantwortlichen
1. Regelungsrahmen
2. Ausgestaltung der Regelung
F. Sachenrecht
I. Allgemeines
II. Unverlangt übersendete Ware
III. Teilzeitnutzungsrechte
G. EU-Vorschriften zum anwendbaren Recht
I.Bedeutung des Kollisionsrechts im Binnenmarkt
1. Rechtsverfolgung und Durchsetzung im Binnenmarkt
2. Europäisches Zivilverfahrensrecht
3. Entwicklung des Kollisionsrechts und spezifische Schwierigkeiten
4.Regelungsziele und grundlegender Konflikt
a) Kollisionsrecht und Binnenmarktverbesserung
b) Binnenmarktausrichtung der Kollisionsnormen
II.Die Rom I-VO
1. Grundsätzliches
2.Sachlicher Anwendungsbereich
a) Allgemeines
b) Culpa in contrahendo
c) Weitere Abgrenzungsfragen zur Rom II-VO
d) Ausgenommene Rechtsfragen
3.Wichtige Kollisionstatbestände
a) Vorrang der Rechtswahl
b) Allgemeine Anknüpfungsregeln
c) Verbraucherverträge
d) Eingriffsnormen
e) Verkehrsschutz vor Minderjährigenschutz
f) Weitere Rechtsfragen
III.Die Rom II-VO und ihre Lücken
1. Grundsätzliches
2. Internationaler und sachlicher Anwendungsbereich
3.Die wesentlichen Anknüpfungstatbestände
a) Der allgemeine Deliktstatbestand
b) Produkthaftung als deliktischer Sondertatbestand
c) Rechtswahl beim Delikt
d) Die Anknüpfung sonstiger außervertraglicher Schuldverhältnisse
IV.Kollisionsrecht im sekundären EU-Recht
1. Allgemeines
2. Der Günstigkeitsgrundsatz
V.Allgemeine Grundsätze
1. Grundfreiheiten und anzuwendendes Recht
2. Begriffsverwendung
3. Konflikt zwischen Herkunftsland-/Anerkennungsprinzip und Kollisionsregeln
4. Kritik
5.Herkunftslandprinzip und schützenswerte Interessen
a) Allgemeines
b)E-Commerce-RL
aa) In der Richtlinie vorgesehene Einschränkungen
bb) Umsetzung des Herkunftslandprinzips für den E-Commerce in § 3 TMG
c) Dienstleistungs-RL
6. Herkunftslandprinzip und Drittstaaten
7. Zusammenfassung
§ 7 Die Zukunft des EU-Privatrechts – Entstehung eines europäischen Vertragsgesetzbuchs?
A. Überblick
I. Eingrenzung
II. Private Arbeitsgruppen und Projekte im Bereich des Vertragsrechts
III. Öffentliche und private Projekte im Bereich der Rechtsvereinheitlichung auf weiteren Gebieten des Privatrechts
B. Entwicklung eines europäischen Vertragsgesetzbuchs
Читать дальше