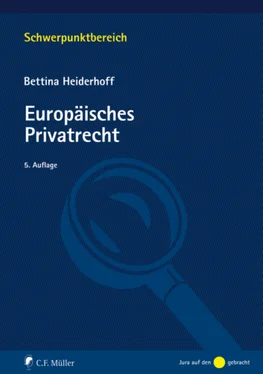§ 4 Umsetzung, Anwendung und Auslegung von EU-Privatrecht› D. Die Vorlage an den EuGH
D. Die Vorlage an den EuGH
§ 4 Umsetzung, Anwendung und Auslegung von EU-Privatrecht› D. Die Vorlage an den EuGH › I. Zuständigkeit für die Auslegung von EU-Recht
I. Zuständigkeit für die Auslegung von EU-Recht
139
Nunmehr wurde gezeigt, wie EU-Recht ausgelegt wird und wie nationales Recht vor dem Hintergrund des EU-Rechts auszulegen ist. Dabei wurde schon deutlich, dass unterschiedliche Zuständigkeiten bestehen. Während nationales Recht nur von den nationalen Gerichten ausgelegt wird, darf EU-Recht nur vom EuGH ausgelegtwerden.
Die Zuständigkeit zur Auslegung des EU-Rechts liegt nach Art. 267 Abs. 1 lit. a) AEUV allein beim EuGH. Der EuGH hat also das Auslegungsmonopol. Der Sinn dieser Regelung leuchtet leicht ein. Würden sich die Gerichte der Mitgliedstaaten an der Auslegung des EU-Rechts versuchen, so würden bald sehr unterschiedliche Deutungen der Normen entstehen. Die Funktion der Rechtsangleichung wäre damit sehr beeinträchtigt. Das Auslegungsmonopol des EuGH dient also der Erzielung bzw. der Wahrung von Rechtseinheit.
Für das Gerichtsverfahren beim EuGH gelten die Verfahrensordnung des EuGH vom 19.6.1991 sowie das Protokoll über die Satzung vom 26.2.2001 (entsprechend Art. 281 S. 1 AEUV). Die grundlegenden Normen sind in den Art. 251 ff. AEUV selbst enthalten.
§ 4 Umsetzung, Anwendung und Auslegung von EU-Privatrecht› D. Die Vorlage an den EuGH › II. Das Vorabentscheidungsverfahren
II. Das Vorabentscheidungsverfahren
140
Literaturhinweis:
Piekenbrock , Vorlagen an den EuGH nach Art. 267 AEUV im Privatrecht, EuR 2011, 317; Rösler , Europäische Gerichtsbarkeit auf dem Gebiet des Zivilrechts, 2012.
Beispiel 7
– nach LG Darmstadt NJOZ 2011, 644: Verbraucherin V hat mit Unternehmer U in ihrer Wohnung einen Vertrag über Telekommunikationsdienstleistungen geschlossen. Da V nicht gezahlt hat, hat U ein Mahnverfahren durchgeführt und schließlich einen Vollstreckungsbescheid über 300 Euro erwirkt, aus dem er nun die Zwangsvollstreckung betreibt. Vom Gerichtsvollzieher erfährt V, dass sie möglicherweise noch ein Widerrufsrecht haben könnte. Sie sucht nun endlich einen Anwalt auf, der gleich sieht, dass der in dem Vertrag enthaltene Hinweis auf das Widerrufsrecht keine ordnungsgemäße Belehrung gem. Art. 246a EGBGB darstellt. Er meint, dass daher gemäß § 356 Abs. 3 S. 2 BGB die Widerrufsfrist noch laufe. V widerruft sogleich den Vertrag und legt sodann eine Vollstreckungsgegenklage beim zuständigen AG Buxtehude ein, um die Einstellung der Vollstreckung zu erreichen. Nun überlegt der Amtsrichter, ob die V mit dem Einwand, sie habe noch nachträglich den Widerruf erklärt, durchdringen kann. Generell möchte er der Rechtsprechung des BGH folgen. Danach kann die Vollstreckungsgegenklage nicht auf die Ausübung eines Gestaltungsrechts gestützt werden, welches der Kläger schon im Ausgangsverfahren hätte geltend machen können (§ 767 Abs. 2 ZPO). Hier hätte die V in der Tat den Vertrag sogleich widerrufen und dies (spätestens) durch Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid (§ 700 ZPO) geltend machen können. Das kommt dem Richter aber komisch vor, weil er der V auf diese Art eine in § 356 Abs. 3 S. 2 BGB ausdrücklich statuierte, auf Richtlinien beruhende Frist abschneiden würde. Nun überlegt er, ob er eine Vorlage an den EuGH nach Art. 267 AEUV tätigen sollte oder ob er dazu gar verpflichtet ist.
141
Nach Art. 267 Abs. 1 AEUV entscheidet der EuGH über Fragen der Auslegung der EU-Verträge sowie über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe der EU. Zu diesen Handlungen gehören die Richtlinien.[111] Für die Auslegung der Richtlinien ist somit allein der EuGH zuständig. Wenn die nationalen Gerichte einen Fall zu entscheiden haben, für den die Auslegung einer Richtlinie von Bedeutung ist, dürfen sie daher die Richtlinie (in der Regel) nicht selbst auslegen, sondern sie müssen das Verfahren aussetzenund dem EuGH die Auslegungsfrage zur Entscheidung vorlegen. Dieses Vorabentscheidungsverfahren bringt einige Schwierigkeiten mit sich.[112]
142
Weitgehend geklärt scheint die Frage, welche Gerichte im Instanzenzug die Vorlage vorzunehmen haben. Nur die letztinstanzlichen Gerichtehaben nach Art. 267 Abs. 3 AEUV die Pflichtzur Vorlage der Rechtsfrage an den EuGH. Es ergibt sich deutlich aus Art. 267 Abs. 2 und Abs. 3 AEUV, dass die Untergerichtezur Vorlage immer nur berechtigt, nicht aber verpflichtet sind. Es liegt also in ihrem Ermessen, ob sie die Vorlage durchführen wollen.[113]
143
Umstritten ist, ob dies anders beurteilt werden muss, wenn gegen die Entscheidung des AG die Berufung nicht statthaft ist, weil der Beschwerdegegenstand 600 Euro nicht übersteigt (§ 511 Abs. 2 Nr. 1 ZPO). Für die Bestimmung des letztinstanzlichen Gerichts kommt es nach heute h.A. nicht darauf an, ob das Gericht abstrakt die letzte Instanz darstellt (wie etwa der BGH), sondern es ist darauf abzustellen, welches Gericht im konkreten Fall die letzte mögliche Instanzfür die Parteien ist.[114] Beachtlich sind nach h.A. alle ordentlichen Rechtsbehelfe, also insbesondere auch die zivilprozessuale Nichtzulassungsbeschwerde (§ 544 ZPO).[115] Die Frage ist wohl deshalb bisher unentschieden, weil sie praktisch nicht allzu relevant ist: Indem das AG die Berufung nach § 511 Abs. 2 Nr. 2 ZPO zulässt, kann es der Vorlagepflicht in jedem Fall entkommen.
144
Da im Beispiel 7der Streitwert unter 600 Euro liegt, ist die Berufung nicht automatisch statthaft (§ 511 Abs. 2 Nr. 1 ZPO). Der Amtsrichter kann die Berufung aber zulassen (§ 511 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 4 ZPO).
Eine Vorlagepflicht besteht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV nur, wenn der Richter die Berufung nicht zulässt, weil das AG dann im konkreten Fall die letzte Instanz ist. Daher muss der Richter sich entscheiden, ob er die Berufung zulässt oder ob er die Sache selbst dem EuGH vorlegt. Es wäre falsch, keinen dieser beiden Wege zu gehen (weiter dazu unten Rn. 146, 154 ff.).
145
Bei der Ermessensentscheidung darüber, ob eine Vorlage schon in einer unteren Instanz erfolgen soll, muss bedacht werden, dass das Vorlageverfahren eine erhebliche Prozessverlängerungmit sich bringt und dass es die Prozesskosten für die Parteien erhöht.[116] Gerade in Rechtsstreitigkeiten, in denen früh zu erkennen ist, dass alles auf eine Frage der Auslegung von EU-Recht hinausläuft, kann eine Vorlage schon durch die Untergerichte aber dennoch sinnvoll sein. Es führt dann nämlich erst recht zu einer Verlängerung des Verfahrens, erst den mitgliedstaatlichen Instanzenzug zu durchlaufen, bevor letztlich doch wegen der Pflicht aus Art. 267 Abs. 3 AEUV die Vorlage an den EuGH nötig wird.[117]
146
Im Beispiel 7muss der Richter also überlegen, wie das Verfahren jeweils weiterlaufen würde und welcher Weg für die Parteien die geringsten Belastungen mit sich bringt. Wenn er selbst eine Entscheidung über die Auslegung der Richtlinie trifft und sodann die Berufung zulässt, kann es bei einem niedrigen Streitwert gut sein, dass die Parteien darauf verzichten, ein Rechtsmittel einzulegen. Andererseits handelt es sich um eine wichtige, eindeutig klärungsbedürftige Frage zur Wirkung einer Richtlinie.[118] Der Amtsrichter darf hier davon ausgehen, dass auch das Berufungsgericht sicher wieder auf dieselbe Frage stoßen wird. Es wird in die gleiche „Zwickmühle“ zwischen der gängigen BGH-Rechtsprechung und dem europäischen Richtlinienrecht geraten (zu dem hier maßgeblichen Verhältnis von Widerrufsfrist und Präklusion gem. § 767 Abs. 2 ZPO inhaltlich noch unten Rn. 366). Eine Vorlage scheint hier alles in allem gut vertretbar.
Читать дальше