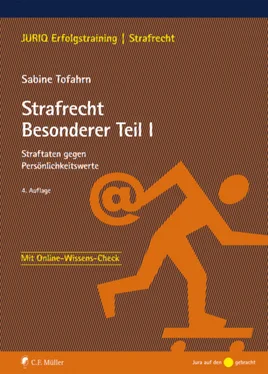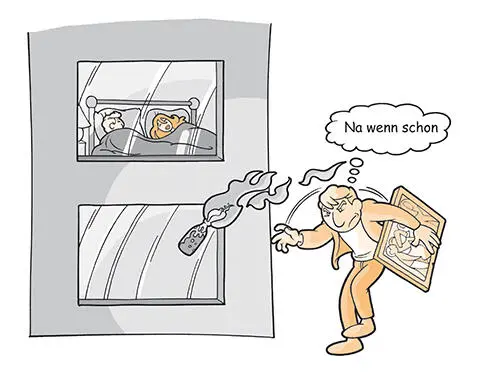Hier kommt Verdeckungsabsicht nicht in Betracht, obgleich eine zu verdeckende strafbare Vortat vorliegt. Da A davon ausgeht, den Strafverfolgungsbehörden bereits bekannt zu sein, gibt es mithin seiner Ansicht zufolge nichts mehr zu verdecken.
75

Die Absicht (dolus directus ersten Grades)muss sich auf die Verdeckungder vorangegangenen Straftat beziehen. Fraglich ist, ob dem Täter auch dann Verdeckungsabsicht unterstellt werden kann, wenn er den Tod des Opfers nur billigend in Kaufnimmt.
Hinweis
Nimmt der Täter den Tod nur billigend in Kauf, dann rechnet er nur mit der Möglichkeit, dass der Tod eintreten kann. Also ist in seinem Vorstellungsbild auch die Möglichkeit enthalten, dass der Tod nicht eintreten kann.
76
Dies richtet sich nach der kriminellen Logik: Grundsätzlich schließen sich bedingter Tötungsvorsatz und die Absicht, eine andere Straftat zu verdecken, nicht aus. Sie lassen sich dann nicht miteinander verbinden, wenn die Verdeckung der Straftat nach der Vorstellung des Täters nur durch den Eintritt des Todeszu erreichen ist. Ist dies nach der Vorstellung des Täters nicht notwendig, so reicht es aus, wenn er den Tod des Opfers lediglich in Kauf nimmt.[64]
Beispiel
A hat seine Freundin F vergewaltigt und danach getötet. Da F ihn kennt und als Täter identifizieren und überführen kann, wird es dem A darauf ankommen müssen, den Tod der F herbeizuführen, wenn er die Straftat verdecken möchte. Der Tod ist also notwendiges Mittel zur Verdeckung. Dolus eventualis würde in einem solchen Fall nicht ausreichen. Es muss jedenfalls dolus directus 2. Grades vorliegen.
Beispiel
A hat im Haus des B einen Einbruchdiebstahl begangen und wertvolle Gemälde an sich genommen. Um diesen Diebstahl zu vertuschen, legt er sodann einen Brand in dem Bewusstsein, dass sich im oberen Stockwerk noch Menschen befinden, die jedoch von dem Einbruch nichts mitbekommen haben. Deren Tod nimmt A billigend in Kauf. Auch in diesem Fall liegt ein Verdeckungsmord vor. Hier schließen sich bedingter Tötungsvorsatz und Verdeckungsabsicht nicht aus, da aufgrund des Umstandes, dass A von den Bewohnern des Hauses nicht identifiziert werden kann, deren Tod nicht notwendiges Mittel zur Verdeckung der vorangegangenen Tat ist. Hier kommt es als notwendiges Mittel ausschließlich auf die Tötungshandlung, nämlich das Brandlegen an.[65]
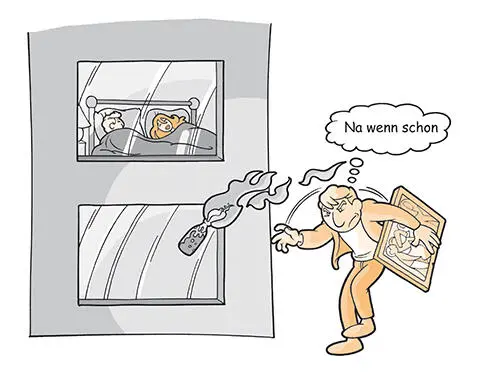
[Bild vergrößern]
JURIQ-Klausurtipp
Prüfen Sie im Einzelfall also genau, ob der Tod ein notwendiges Mittelzur Verdeckung ist. Reicht dem Täter zur Verdeckung die Tötungshandlung, dann reicht bezüglich des Todes dolus eventualis.
77

Problemein Zusammenhang mit der Verdeckungsabsicht können Ihnen in der Klausur schließlich begegnen, wenn der Täter eine zuvor begangene Körperverletzung oder Vergewaltigung, bei welcher er das Opfer unvorsätzlich lebensgefährdend verletzt hat, verdeckenmöchte, indem er es unterlässt, das Opfer zu retten, z.B. durch das Herbeirufen von Rettungskräften. Problematisch ist hier weniger die Verdeckungsabsicht als vielmehr die Gleichstellungsklausel gem. § 13. Demnach muss bei einem Unterlassungsdelikt das Unterlassen dem positiven Tun im Unwertgehalt entsprechen.
78
Beim Zusammentreffen eines Unterlassungsdelikts mit Verdeckungsabsicht wird teilweise in der Literaturdie Gleichwertigkeit des Unterlassens mit dem Handeln gemäß § 13 verneint. Bei einem Verdeckungsmord durch aktives Tun besteht der an den Täter gerichtete Appell darin, dass von ihm verlangt wird, nicht weiter zu töten und sich damit eventuell der Gefahr der Strafverfolgung auszusetzen. Bei einem Verdeckungsmord durch Unterlassen würde jedoch, so die Literatur, von dem Täter verlangt, aktiv das Opfer zu retten und damit sich der Gefahr der Strafverfolgung auszusetzen. Damit, so die Literatur, entspreche das Unterlassen von der Wertigkeit her nicht dem aktiven Tun,da das Unterlassen vor dem Hintergrund des Risikos der Strafverfolgung „weniger kriminell“ sei.[66]
79
Lesen Sie hierzu den Übungsfall "Kevin in Not" im Skript „Strafrecht AT II“.
Zwar unterlässt beim Verdeckungsmord durch Unterlassen der Täter nur die Rettung des Opfers, wohingegen er beim Begehungsdelikt aktiv eine weitere Tat zur Verdeckung begeht. Dies macht jedoch insbesondere bei einer Garantenstellung aus Ingerenz, bei welcher der Täter zuvor die Gefahr, deren Abwendung er jetzt unterlässt, selbst geschaffen hat, keinen Unterschied. Der Handlungsunwert ist in beiden Fällen gleich, da die Untätigkeit auf einem selbst verursachten Handlungsappell beruht. Der BGH [67] geht daher davon aus, dass auch bei einem Verdeckungsmord durch Unterlassen das Unterlassen dem Handeln gleichsteht.
2. Teil Straftaten gegen das Leben› C. Mord, § 211› VIII. Rechtswidrigkeit und Schuld
VIII. Rechtswidrigkeit und Schuld
80
Insofern gibt es keine deliktsspezifischen Besonderheiten. Es gelten die allgemeinen Grundsätze.
2. Teil Straftaten gegen das Leben› C. Mord, § 211› IX. Täterschaft und Teilnahme
IX. Täterschaft und Teilnahme
81
Bei der Täterschaft und Teilnahme wird das oben beschriebene Verhältnis von Mord und Totschlag zueinander relevant. Erheblich ist ferner die Einordnung der Mordmerkmale als tat- und täterbezogene Mordmerkmale.
82
Die objektiven tatbezogenen Mordmerkmalewerden Mittätern, mittelbaren Tätern und Teilnehmern zugerechnet, wenn sich deren Vorsatz auf die Verwirklichung der Merkmale durch den unmittelbar Handelnden richtet. § 28 ist an dieser Stelle nicht anwendbar!
Setzen Sie sich an dieser Stelle mit den Prüfungsschemata von Mittäterschaft, mittelbarer Täterschaft und von Anstiftung und Beihilfe auseinander, dargestellt im Skript „Strafrecht AT II“.
Beispiel
A tötet mit einem Jagdgewehr, welches ihm F besorgt hat, seine Eltern hinterrücks. F hat sich wegen Beihilfe zum Mord strafbar gemacht, wenn sie die Umstände der Tatbegehung kannte und dementsprechend wusste, dass A einen heimtückischen Mord und nicht nur einen Totschlag begehen wird. Sofern F umfangreicher an der Tat mitgewirkt hat und dabei aufgrund von Tatherrschaft Täterin ist, gilt das Gleiche: weiß sie von der Art und Weise der Tatbegehung und entspricht die Tatausführung dem gemeinsamen Tatplan, dann wird ihr die heimtückische Tötung über § 25 Abs. 2 zugerechnet.
83
Die subjektiven täterbezogenen Mordmerkmalemüssen bei den jeweiligen (Mit-)Täternvorliegen. Eine Zurechnung kommt nicht in Betracht. Problematischist der Fall, in dem ein Mittäter ein täterbezogenes Mordmerkmal verwirklicht, der andere aber nicht.
Beispiel
A und B wollen gemeinsam C töten. A soll C festhalten, während B ihm das Messer in den Bauch rammen soll. Wie verabredet gehen sie vor. Während B die Tat aus Habgier begeht, liegt bei A kein Mordmerkmal vor.
Im Rahmen von § 25 Abs. 2 müsste dem A die Tathandlung des B zugerechnet werden, damit A wegen gemeinschaftlich begangenen Totschlages verurteilt werden kann. B hat jedoch einen Mord und keinen Totschlag begangen. Fraglich ist, ob die (Mord-) Handlung dem Totschlag zugerechnet werden kann. Die Literatur[68] hat damit kein Problem, da der Totschlag als Grunddelikt im Mord mit enthalten ist. Nach Auffassung des BGH [69] dürfte eine Zurechnung eigentlich nicht möglich sein, da beide Delikte selbstständig sind. Der BGH vermeidet diese unbefriedigende Lösung jedoch dadurch, dass er ausführt, der Unwertgehalt des Totschlages sei im Mord mit enthalten, weswegen eine Zurechnung möglich sei.
Читать дальше