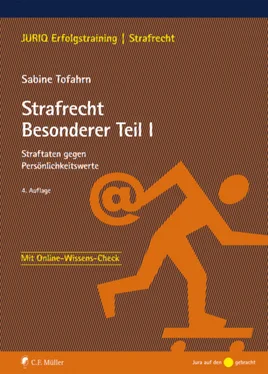Beispiel
Der sadomasochistisch veranlagte A sucht im Internet nach einem Gleichgesinnten, der bereit ist, sich töten und danach zerstückeln zu lassen. Von der Zerstückelung verspricht er sich sexuellen Lustgewinn. Er findet B, den er absprachegemäß erst tötet und dann vor laufender Kamera zerstückelt. Dabei ist es ihm wichtig, dass B mit dieser Vorgehensweise, insbesondere auch mit seiner Tötung, einverstanden ist.[53]
Eine Tötung auf Verlangen gem. § 216 kommt nicht in Betracht, da A nicht durch das Verlangen des B zur Tötung bestimmt wurde. Es liegt aber ein Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs und in Ermöglichungsabsicht vor. Die zu ermöglichende Straftat ist die Störung der Totenruhe gem. § 168, die aufgrund des geschützten Rechtsguts (allgemeines Pietätsempfinden) auch dann vorliegt, wenn der zu Tötende mit dieser Störung einverstanden ist. Das Landgericht hatte erstinstanzlich hier sogar die bereits beschriebene Rechtsfolgenlösung angewandt und gem. § 49 Abs. 1 Nr. 1 analog nur eine zeitige Freiheitsstrafe verhängt. Begründet hat es dies mit dem Einverständnis des Opfers und dem Umstand, dass dem Täter dieses einvernehmliche Handeln wichtig gewesen sei. Der BGH [54] hat das Urteil aufgehoben und auf lebenslange Freiheitsstrafe erkannt, da er keine außergewöhnlichen Umstände erkennen konnte, die eine Absenkung des Strafrahmens hätten rechtfertigen können.
2. Zur Verdeckung einer Straftat
70
Im Gegensatz zur Ermöglichungsabsicht ist die Verdeckungsabsicht problematischer, da sie häufig in einer Konfliktsituationentsteht, in welcher der Täter bestrebt ist, sich oder eine ihm nahe stehende Person durch Tötung des einzigen Zeugen der drohenden Strafverfolgung zu entziehen. Im Gegensatz zu den §§ 257, 258, die deutlich machen, dass die Selbstbegünstigung bzw. die Strafvereitelung zu eigenem Gunsten straflos ist, wirkt sich die „Selbstbegünstigung“in diesem Fall zu Lasten des Tätersaus. Der Unterschied und damit auch der Grund für die Aufnahme des Merkmals in den Tatbestand des § 211 liegt darin, dass bei einer Tötung zur Verdeckung bereits begangenes Unrecht mit weiterem Unrecht verknüpftwird, wohingegen bei der Strafvereitelung oder der Begünstigung der Täter nur die Wiederherstellung des gesetzmäßigen Zustandes bzw. die Strafverfolgung verhindern will. Darüber hinaus ist das Merkmal aus Gründen des Opferschutzesmit in den Tatbestand aufgenommen worden. Da die Gefahr sehr groß ist, dass ein zum Beispiel auf frischer Tat entdeckter Einbrecher glauben könnte, er habe nichts mehr zu verlieren und könne nun auch gleich den Zeugen beseitigen, ist es angebracht, dieser zu erwartenden Eskalation durch die höchste Strafdrohung, die das Gesetz vorsieht, entgegen zu wirken.[55]
71
Die andere Straftat,die es zu verdecken gilt, muss nicht notwendigerweise tatsächlich vorliegen, es genügt auch hier, dass der Täter glaubt, eine solche Straftat liege vor. Erforderlich ist jedoch, dass es sich bei dem vorgestellten Geschehen um eine Straftat und nicht lediglich um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Diese Straftat kann – wie bei der Ermöglichungsabsicht auch – eine fremde oder eine eigene tatbestandsmäßige und rechtswidrige Tat sein.[56]
Beispiel
Staatsanwalt S glaubt irrig, seine Ehefrau habe einen groß angelegten Aktienbetrug begangen, dem sein Kollege T nunmehr auf der Spur sei. Um die Aufdeckung dieser Tat zu verhindern, tötet S den T und bereinigt die entsprechenden Ermittlungsakten. Dabei stellt er fest, dass gar kein Ermittlungsverfahren gegen seine Frau lief.
Hier hat S unstreitig einen Verdeckungsmord begangen. Die Tötung des T war Mittel zum Zweck der vermeintlichen, von S angenommenen Straftat der Ehefrau.
Nach h.M.ist es auch unbeachtlich, aus welchen Gründen der Täter die Vortat verdecken möchte. Meistens wird der Täter handeln, um einer strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen. Es reicht aber auch aus, wenn er lediglich außerstrafrechtliche Konsequenzenvermeiden möchte, so z.B. eine Rufschädigung im Milieu.[57]
72

Problematischsind die Fälle, in welchen der Täter den Entschluss zum Tötennicht erst geraume Zeit nach Begehung der Vortat fasst, sondern im unmittelbaren Anschluss während oder sofort nach der Vortatbegehung.
Beispiel
A, B und C planen, die von zu Hause aus arbeitende Prostituierte P zu überfallen und auszurauben. Geplant ist, P zunächst durch einen oder mehrere Schläge bewusstlos zu schlagen und dann die Wohnung nach Geld oder Wertsachen zu durchsuchen. Nachdem A der bis dahin ahnungslosen P zunächst den ersten Schlag versetzt hat, der schon zu einer kurzfristigen Bewusstlosigkeit führt, eskaliert die Situation dahingehend, dass nun alle drei Täter wechselseitig auf P eintreten und einschlagen, wobei die Intensität steigt. Schließlich fesseln sie die auf dem Bauch liegende P derart, dass eine Selbststrangulation möglich ist. Spätestens jetzt haben sie den Vorsatz, P zu töten.[58]
73
Der BGH [59] hat deutlich gemacht, dass ein Verdeckungsmord nicht schon dann ausscheidet, wenn Vortat und Tötung in der Angriffsrichtung übereinstimmenund unmittelbar ineinander übergehen. Sofern der spontane Tötungsentschluss auf einer Kurzschlusshandlung beruhe, könne § 21 in Verbindung mit § 49 Abs. 1 Nr. 1 ausreichende Möglichkeiten für eine eventuelle Strafmilderung bieten.[60] Für einen Verdeckungsmord ist dann allerdings kein Raum, wenn der Täter von Anfang an zumindest mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt hat und die zuvor begonnene Tötung des Opfers durch die nachfolgende Tötung mit anderen Mitteln lediglich vollenden will. Sofern ein einheitlicher Tötungsvorsatzvorliegt, will der Täter keine andere Straftatverdecken, sondern nur die Straftat, die er begonnen hat, vollenden. Etwas anderes gilt nur dann, wenn zwischen der zunächst erfolglosen Tötungshandlung und der weiteren Tötungshandlung eine deutliche Zäsurliegt.[61]
Beispiel
Im obigen Fall war nun problematisch, wann sich der Körperverletzungsvorsatz, der beim ersten Schlag jedenfalls noch vorlag, in einen Tötungsvorsatz gewandelt hatte. Beim Fesseln als letzten Akt hatten die Täter wohl zweifelsfrei Tötungsvorsatz und wollten jetzt auch verhindern, dass P sie wegen der exzessiven Gewalt anzeigt. Hätten sie bei den eskalierenden Gewalthandlungen nur Körperverletzungsvorsatz gehabt, dann wäre darin nur eine Köperverletzung zu sehen, die die Täter verdecken könnten. Hätten sie jedoch unmittelbar nach dem ersten Schlag Tötungsvorsatz entwickelt, dann hätten die Täter mit der Fesselung nur das fortgesetzt, was sie bereits begonnen hatten, so dass keine „andere“ Tat angenommen werden könnte. Lässt sich nicht mehr feststellen, wann sich der Körperverletzungsvorsatz wandelte, müsste in dubio pro reo angenommen werden, dass das bereits nach dem ersten Schlag der Fall war.[62]
74
Des Weiteren ist erforderlich, dass die Absicht, die andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, die Triebfeder des Handelnsbildet. Sofern der Täter davon ausgeht, dass es nichts mehr oder noch nichts zu verdecken gibt, kann Verdeckungsabsicht nicht angenommen werden.[63]
Beispiel
A hat in der Bank einen Raubüberfall begangen und ist auf der Flucht. Aufgrund der Überwachungskameras und der einschlägigen Vorstrafen geht A zu Recht davon aus, dass die Strafverfolgungsbehörden seine Identität bereits festgestellt haben. Auf der Flucht erschießt er dennoch einen Polizeibeamten, um seine drohende Festnahme zu verhindern.
Читать дальше