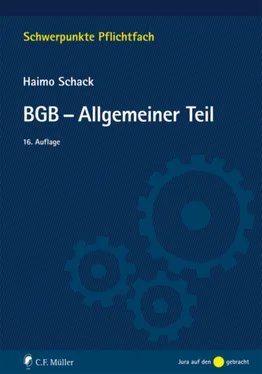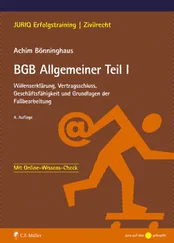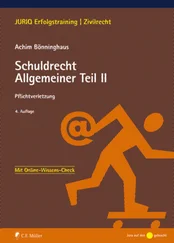1 ...6 7 8 10 11 12 ...26 41
2. Von der ausgeschlossenen Verlängerung der Rechtsfähigkeit über den Tod hinaus zu unterscheiden ist die Wirksamkeit von Willenserklärungen des Verstorbenen für die Zeit nach seinem Tod. Typisch hierfür ist die letztwillige Verfügung (Testament), mit der der Erblasser seinen Erben bestimmen kann, § 1937.
Hierher gehört auch die Vollmacht, die den Tod des Vollmachtgebers überdauern soll. Der Vertreter vertritt dann die Erben, nicht den Verstorbenen. Aus §§ 168 Satz 1, 672 folgt, dass die Vollmacht über den Tod des Vollmachtgebers hinaus wirkt, wenn er nichts anderes bestimmt hat. Der Bevollmächtigte hat nach dem Tod des Vollmachtgebers den Willen der Erben als der neuen Auftraggeber (§ 1922 I) zu beachten. Doch bleibt die postmortale Vollmacht, solange sie nicht widerrufen wird, nach hM den Interessen des Erblassers verpflichtet und damit ein bedenkliches Instrument, erbrechtliche Bindungen und Formvorschriften zu umgehen.
Vgl BGH NJW 1995, 250; Hübner 2Rn 1268 ff; mit Flume II 3§ 51, 5; Medicus/Petersen , Bürgerliches Recht 262017, Rn 399. In der Praxis häufig und für die Erben besonders gefährlich sind Bankaufträge zugunsten Dritter auf den Todesfall, wenn man mit der hM (zB BGH NJW 1975, 382 = Schack/Ackmann 7Nr 100) von einem Vorrang des § 331 I vor § 2301 ausgeht.
Derartige Überlegungen begrenzen die Möglichkeit des F im Fall 2nicht: Die Geltendmachung der Forderung liegt im Interesse des Erben und entspricht auch dessen mutmaßlichem Willen. F könnte also aufgrund der ihm von V erteilten Vollmacht schon vor Klärung der Erbfolge für den Erben die Forderung gegen K geltend machen.
42
Lösungsskizze zu Fall 2 ( Rn 17):
| 1. |
Um die drohende Verjährung zu hemmen, ist es notwendig oder wenn man § 211 (entgegen oben Rn 36) im vorliegenden Fall eingreifen lässt, zumindest empfehlenswert, die Forderung des V einzuklagen. |
| 2. |
Die Klage muss vom „Berechtigten“ erhoben werden (§ 209 I aF, in § 204 I Nr 1 nF nicht mehr ausdrücklich hervorgehoben). Nach seinem Tod ist V nicht mehr Forderungsinhaber. Berechtigt ist jetzt der Erbe. a) Unsicherheit über die Erbenstellung von S oder B, weil S verschollen ist. b) Die Todeserklärung des S schafft eine Vermutung, die es der B erlaubt, die Forderung als Erbin geltend zu machen. |
| 3. |
Der berechtigte Forderungsinhaber kann sich bei Geltendmachung der Forderung vertreten lassen. a) Dem F ist von V Vollmacht erteilt worden. b) Die Vollmacht wirkt über den Tod des V hinaus. F ist deshalb Stellvertreter des Erben, für den er die Forderung geltend machen kann. |
Teil I Die Rechtssubjekte› § 3 Das subjektive Recht. Handlungs- und Deliktsfähigkeit. Erwerb und Verteidigung subjektiver Rechte
§ 3 Das subjektive Recht. Handlungs- und Deliktsfähigkeit. Erwerb und Verteidigung subjektiver Rechte
Inhaltsverzeichnis
I. Objektives und subjektives Recht
II. Handlungsfähigkeit, Arten der Handlung
III. Schutz und Grenzen der subjektiven Rechte
43
Fall 3:
Der 14-jährige A ist „Chef“ einer Bande von Kindern, die aus Langeweile auch schon mal Erwachsene ärgert. Eines Tages verabreden die Kinder als „Mutprobe“, Passanten aus einem Versteck heraus mit Eiern und Tomaten zu bewerfen. Die 83-jährige F wird alsbald von A und dem sechsjährigen B getroffen. Ihr Mantel und ihr neuer Hut sind verschmutzt, der Hut lässt sich nicht mehr reinigen. Der rüstige Rentner R, der alles beobachtet hat, stellt die Kinder zur Rede und verpasst A und B zur Strafe ein paar kräftige Ohrfeigen.
| 1. |
F hatte für den Hut 100 € bezahlt. Kann sie das Geld von den Kindern ersetzt verlangen? |
| 2. |
B hat aufgrund der Ohrfeigen eine geschwollene Backe und eine kleine Platzwunde; er leidet zudem unter Kopfschmerzen und Übelkeit. Können seine Eltern von R Schmerzensgeld für B verlangen? (Lösungsskizze: Rn 57) |
Teil I Die Rechtssubjekte› § 3 Das subjektive Recht. Handlungs- und Deliktsfähigkeit. Erwerb und Verteidigung subjektiver Rechte› I. Objektives und subjektives Recht
I. Objektives und subjektives Recht
44
1. Rechtsfähigkeit bedeutet die Fähigkeit eines jeden Menschen, Träger von Rechten (und Pflichten) zu sein (s. oben Rn 4). Diese einer Person zukommenden Rechte bezeichnet man als subjektive Rechte. Ob und mit welchem Inhalt ein subjektives Recht besteht, sagt das objektive Rechtals die Summe aller Rechtsnormen, zu denen Gesetze, Verordnungen, Satzungen, aber auch das ungeschriebene Gewohnheitsrecht gehören (vgl Art. 2 EGBGB). Das objektive Recht schafft Rechtsverhältnisse, das sind rechtlich geregelte Beziehungen zwischen Personen (Schuldverhältnisse, Familienrechtsverhältnisse) oder zwischen einer Person und einer Sache (vgl indes auch Wolf/Neuner 11§ 19 Rn 6).
Schuldverhältnisse im Sinne einer komplexen Einheit von Rechten und Pflichten werden entweder durch Rechtsgeschäft (in aller Regel einen Vertrag) oder unmittelbar durch das Gesetz begründet, dann spricht man von gesetzlichen Schuldverhältnissen. So muss, wer eines der in § 823 I genannten Rechte eines anderen widerrechtlich und schuldhaft verletzt, diesem Schadensersatz leisten. Hier haben A und B das Eigentum, ein subjektives Recht, der F verletzt mit der Folge, dass der F ein Schadensersatzanspruch, dh wiederum ein subjektives Recht aus dem gesetzlichen Schuldverhältnis des § 823 I, zustehen könnte.
45
2. Das subjektive Rechtstellt also nur einen personenbezogenen Ausschnitt aus dem objektiven Recht dar. Die Erscheinungsformen des subjektiven Rechts sind sehr vielfältig. So sind das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Persönlichkeitsrecht und das Eigentum (§ 903) ebenso subjektive Rechte, wie etwa die Rechte des Käufers einer mangelhaften Sache (§ 437) oder das Auskunftsrecht des Aktionärs gegenüber dem Vorstand einer Aktiengesellschaft (§ 131 AktG). Diese Beispiele zeigen bereits, dass es eine allgemeine, inhaltliche Definition des subjektiven Rechts nicht geben kann. Das subjektive Recht ist vielmehr eine Denkfigur, mit der die Rechtsordnung die Handlungsfreiheit der selbstbestimmten Persönlichkeit gewährleisten will. So hat Bernhard Windscheid (1817–1892) das subjektive Recht als „von der Rechtsordnung verliehene Willensmacht“ bezeichnet. Subjektive Rechte ermöglichen damit die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung des Individuums. Allerdings geht es kaum jemals um unbeschränkte „Macht“ des Einzelnen. Der Gesetzgeber verleiht subjektive Rechte vielmehr nur zur Befriedigung schutzwürdiger Interessen. Deshalb bedarf das subjektive Recht einer normativen Ergänzung im Sinne eines „rechtlich geschützten Interesses“ ( Rudolf von Ihering , 1818–1892). Subjektive Rechte werden deshalb ausdrücklich oder immanent durch die Rechte anderer beschränkt; vgl §§ 903 Satz 1, 906 BGB, Art. 14 II GG. Behält man diese Sozialbindung im Auge, dann ist das subjektive Recht in einer liberal-individualistischen Rechtsordnung im ausgehenden 19. Jh genauso wie heute von zentraler Bedeutung.
46
3. Jede Einteilung der subjektiven Rechte (vgl etwa Wolf/Neuner 11§ 20 Rn 14 ff) ist in gewissem Grade willkürlich, schärft jedoch den Blick für Gemeinsamkeiten wie Unterschiede, etwa hinsichtlich der Übertragbarkeit der Rechte oder hinsichtlich des Kreises ihrer Adressaten.
a) Zum Schutz der Selbstbestimmung und Achtung der Person werden jedem Menschen Persönlichkeitsrechtezuerkannt (näher unten Fall 4). Diese Rechte sind höchstpersönlich, dh nicht von der Person ihres Trägers ablösbar, also auch nicht übertragbar. Als absolute Rechte sind die Persönlichkeitsrechte von jedermann zu respektieren.
Читать дальше