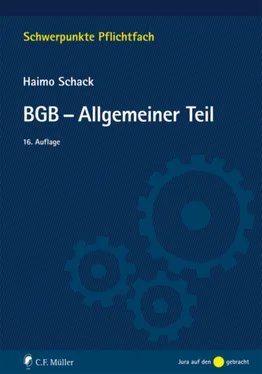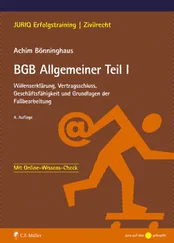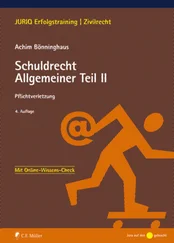1 ...7 8 9 11 12 13 ...26 b) Gegenüber jedermann wirken auch die Herrschaftsrechte, die dem Rechtsinhaber erlauben, Dritte von der Nutzung des Gegenstandes auszuschließen, auf den sich das Recht bezieht (Ausschließlichkeitsrecht). Herrschaftsrechte können bestehen an Sachen (sog. dingliche Rechte), also an körperlichen Gegenständen wie einem Buch oder einem Schmuckstück, aber auch an Immaterialgütern (vgl das Recht des Urhebers gemäß §§ 11 ff, 2 UrhG) und an Rechten (zB Nießbrauch an Rechten, §§ 1068 ff). Das wichtigste Herrschaftsrecht an Sachen ist das Eigentum. Dieses subjektive Recht der F ist im Fall 3verletzt worden.
47
c) Eine weitere Gruppe subjektiver Rechte bilden die Ansprüche. Ansprüche wirken relativ, dh nur gegenüber ganz bestimmten Personen. Sie beinhalten das Recht der einen Person, von einer anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (§ 194 I). Die meisten Ansprüche entstehen aus Schuldverhältnissen, zB aufgrund eines Vertrages oder einer unerlaubten Handlung. Solche Ansprüche nennt man Forderungen, vgl § 241 I. Ansprüche können aber auch als Folge der Verletzung eines Herrschaftsrechts, etwa des Eigentums, entstehen, wie der Herausgabeanspruch des Eigentümers gegenüber dem Besitzer gemäß § 985 (sog. dinglicherAnspruch). Allen Ansprüchen gemeinsam ist, dass sie keine sonstigen Rechte iSv § 823 I darstellen, da sie nur relativ zwischen einzelnen Personen wirken, also nicht mit absoluter Wirkung gegenüber jedermann ausgestattet sind.
48
d) Inhalt eines subjektiven Rechts kann auch sein, dass der Berechtigte ein Rechtsverhältnis einseitig gestalten, insbesondere beenden kann. Solche Gestaltungsrechtesind zB das Anfechtungsrecht wegen Irrtums (§§ 119 ff, 142 I) und das Kündigungsrecht etwa in §§ 542 ff, 626. Auch Gegenrechte, wie zB die Aufrechnungsbefugnis (vgl §§ 388 f), gehören hierher.
e) Zu den subjektiven Rechten zählen auch Mitwirkungs- und Stimmrechte etwa eines Vereinsmitglieds oder eines Aktionärs. Manche Rechte, wie vor allem die elterliche Sorge als „die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen“ (§§ 1626, 1631), zeichnen sich durch eine starke gleichzeitige Pflichtenbindung aus. Hier erweist der Kindesherausgabeanspruch in § 1632 I deutlich das subjektive Recht als eine bloße juristische Denkform.
49
Neben den subjektiven Privatrechten gibt es auch sog. subjektiv-öffentliche Rechte. Enthalten Erstere die Befugnisse des Einzelnen gegenüber anderen Bürgern, so sichern Letztere, allen voran die Grundrechte des Grundgesetzes, vornehmlich die Rechte des Bürgers gegenüber dem Staat. Zwischen dem subjektiv-öffentlichen Recht und dem subjektiven Privatrecht gibt es keine starre Trennlinie, sie beeinflussen sich vielmehr gegenseitig. Auch untereinander können sich die Bürger bei der rechtlichen Beurteilung ihrer Angelegenheiten auf die grundlegenden Wertentscheidungen der Verfassung, vor allem auf die Grundrechte, berufen. So müssen bei der rechtlichen Bewertung von ehrverletzenden Äußerungen auch die Grundrechte der Meinungs- und der Kunstfreiheit (Art. 5 I und III GG) des Äußernden berücksichtigt werden (grundlegend BVerfGE 7, 198). Insoweit besteht eine Drittwirkung der Grundrechte, die in das Zivilrecht vor allem über die Generalklauseln der §§ 138, 242, 826 einfließen (vgl BVerfG JZ 2018, 930 Tz 32 ff: Stadionverbot; Kingreen/Poscher , Grundrechte. Staatsrecht II 342018, Rn 236 ff; und zu Art. 3 III GG BGH NJW 2012, 1725, 1727: Hausverbot für NPD-Vorsitzenden).
50
4. Der Erwerbsubjektiver Rechte kann originär oder derivativ stattfinden. Ein abgeleiteter (derivativer)Erwerb liegt vor, wenn das Recht von einem Rechtsvorgänger erworben wird, wenn dieser das Recht zB auf den Rechtsnachfolger überträgt. Hauptfälle sind die Übereignung von Sachen gemäß §§ 873 ff, 929 ff und die Abtretung von Forderungen gemäß § 398 durch den Zedenten (Altgläubiger) an den Zessionar (Neugläubiger). Zu einer Rechtsnachfolge kommt es auch im Erbfall, §§ 1922, 1967 (Universalsukzession).
Dagegen ist im Falle des originärenErwerbs die subjektive Rechtsposition nicht von einem Rechtsvorgänger abgeleitet, sondern das Recht entsteht erst mit dem Erwerb. Wichtige Beispiele hierfür sind §§ 946 ff. So wird bei der Verarbeitung gemäß § 950 I der Verarbeitende Eigentümer der neu hergestellten Sache ohne Rücksicht auf das Eigentum an den Ausgangsmaterialien. Andere Beispiele für einen originären Rechtserwerb sind die Aneignung einer herrenlosen beweglichen Sache (§ 958), aber auch die Begründung einer Forderung durch Abschluss eines Vertrages (§§ 311 I, 241).
51
5. Das Erlöschensubjektiver Rechte kann sich aus vielerlei Tatbeständen ergeben, etwa aus Verzicht und Erlass (§ 397). Andere Rechte wie die Gestaltungsrechte verbrauchen sich durch ihre Ausübung oder sie erlöschen durch Fristablauf. So kann etwa eine Kündigung wirksam nur einmal und nur binnen bestimmter Frist erfolgen. Herrschaftsrechte verliert der Rechtsinhaber mit Untergang des Gegenstandes, aber auch wenn dieser auf einen Dritten übertragen wird. Bisweilen entsteht mit dem Untergang eines Gegenstandes auch ein neues subjektives Recht, zB ein deliktischer Ersatzanspruch. Dieser ist mit dem Herrschaftsrecht nicht identisch, er tritt lediglich an dessen Stelle. Forderungen erlöschen mit ihrer Erfüllung (§ 362). Einige Rechte, wie der Nießbrauch (§ 1061), enden mit dem Tod des Rechtsträgers, andere nach Ablauf bestimmter Schutzfristen, wie das Urheberrecht 70 Jahre nach dem Tode des Urhebers (§ 64 UrhG).
Teil I Die Rechtssubjekte› § 3 Das subjektive Recht. Handlungs- und Deliktsfähigkeit. Erwerb und Verteidigung subjektiver Rechte› II. Handlungsfähigkeit, Arten der Handlung
II. Handlungsfähigkeit, Arten der Handlung
52
Neben der Verletzung des Eigentums setzt ein Schadensersatzanspruch der F gegen A und B weiter voraus, dass die Kinder rechtlich für ihr Verhalten verantwortlich gemacht werden können. Hier kommt eine Verpflichtung zur Zahlung von 100 € aufgrund des Deliktstatbestandes von § 823 I in Betracht. Da A und B noch nicht erwachsen sind, ist fraglich, ob sie durch ihr Handeln Rechtsfolgen auslösen können.
1. Handlungsfähigkeitbedeutet, durch eigene Handlungen Rechte und Pflichten begründen, sich rechtserheblich verhalten zu können. Ist eine Person, zB ein Neugeborenes, nicht handlungsfähig, dann können andere für sie handeln. Das ist notwendig, damit das Rechtssubjekt am Rechtsverkehr überhaupt teilnehmen kann (s. oben Rn 5). Der allgemeine Begriff der Handlungsfähigkeit kommt im Gesetz nicht vor. Das BGB unterscheidet nur nach Art der jeweiligen Handlung besondere Handlungsfähigkeiten, so zB für das rechtsgeschäftliche Handeln die Geschäftsfähigkeit (sie entscheidet, ob und unter welchen Bedingungen Kinder Verträge schließen können, vgl §§ 104 ff und unten Rn 190 ff) und die Deliktsfähigkeit als Voraussetzung der Verantwortlichkeit für unerlaubtes Verhalten (Tun oder Unterlassen), hier für die Haftung von A und B aus Delikt gemäß § 823.
53
2. Die Aufgliederung der Handlungsfähigkeit in Teilbegriffe beruht darauf, dass einem Menschen nur solches Verhalten, insbesondere eines mit Haftungsfolgen, zugerechnet werden darf, das er steuern und in seiner rechtlichen Bedeutung erkennen konnte. Diese Zurechnungsvoraussetzungen sind verschieden, je nachdem ob es sich um ein Rechtsgeschäft, um eine unerlaubte Handlung oder um ein erlaubtes, tatsächliches Tun (einen sog. Realakt) handelt. Auf dieser Grundlage unterscheidet das BGB die Geschäftsfähigkeit(= Fähigkeit, durch eigene Willenserklärungen Rechte und Pflichten begründen zu können) von der Deliktsfähigkeit(= Fähigkeit, durch eigenes tatsächliches Verhalten Pflichten zu begründen). Von der Willens- und Erkenntnisfähigkeit unabhängig ist die Fähigkeit, Realakte zu bewirken. Beim Realakt kommt es nur auf den tatsächlichen Erfolg an: Auch ein Geisteskranker kann ein Kunstwerk schaffen (vgl § 7 UrhG), auch ein Kind einen Schatz finden (§ 984).
Читать дальше