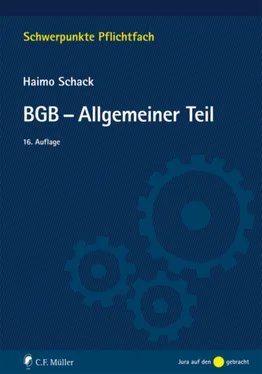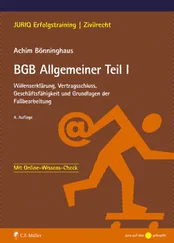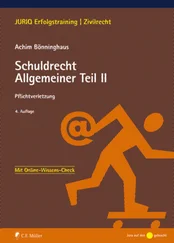Um Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts angemessen sanktionieren zu können, setzt sich die Rechtsprechung deshalb rechtsfortbildend über den Wortlaut des § 253 hinweg und gewährt einen Schadensersatz in Geld für den immateriellen Schaden (erstmals im Herrenreiterfall BGHZ 26, 349; gebilligt von BVerfGE 34, 269. Lesenswert auch der Ginsengfall BGHZ 35, 363). Hier jedoch verlangt F kein Schmerzensgeld (zu dessen Bemessung bei der Veröffentlichung eines „oben ohne“-Fotos in einer Zeitschrift OLG Oldenburg NJW 1989, 400). F will vielmehr für die Zukunft ein bestimmtes Verhalten des A erzwingen.
67
Der Abwehr eingetretener und künftiger Störungen dienen Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche, die von der Existenz eines Schadens und vom Verschulden des Störers unabhängig sind. Derartige Abwehransprüche sieht § 1004 zum Schutz des Eigentums vor (sog. actio negatoria); ebenso für bestimmte andere Rechte zB § 12 BGB, § 37 II 1 HGB, § 97 I 1 UrhG. Dieser Rechtsgedanke lässt sich auch für andere absolut geschützte Rechtsgüter dienstbar machen, die nicht weniger schutzwürdig sind als das Eigentum. Zum Schutz aller Rechtsgüter des § 823 sind deshalb analog § 1004 (sog. quasinegatorische) Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche anerkannt, die insbesondere für den Persönlichkeitsschutz von zentraler Bedeutung sind (BGHZ 91, 233, 239).
68
Der Unterlassungsanspruch ist begründet, wenn künftige Störungen zu befürchten sind, § 1004 I 2 (Wiederholungsgefahr), darüber hinaus aber auch, wenn eine Störung erstmals ernsthaft droht (vorbeugende Unterlassungsklage). Mit dem Urteil werden für den Fall der Zuwiderhandlung Geld- und Haftstrafen angedroht, § 890 ZPO.
Mit dem Unterlassungsanspruch könnte F erreichen, dass dem A untersagt wird, das Bild anderen Personen zugänglich zu machen. Es wird allerdings nicht einfach sein, dieses Verlangen so genau zu bezeichnen, dass dem prozessualen Gebot eines bestimmten (vollstreckungstauglichen) Klageantrages, § 253 II Nr 2 ZPO, genügt wird.
69
Der daneben bestehende Beseitigungs anspruch bezweckt, die Störungsquelle zu verstopfen (vgl BGHZ 97, 231, 236 f). Das ist nicht zu verwechseln mit dem verschuldensabhängigen Anspruch auf Ersatz eines endgültig eingetretenen Schadens! Vgl Westermann/Gursky/Eickmann , Sachenrecht 82011, § 35 Rn 18.
Damit könnte F die Vernichtung des rechtswidrig hergestellten Bildes und des Negatives erreichen, nicht aber deren Herausgabe. Der Beseitigungsanspruch reicht nur soweit, wie zur Beseitigung der Störung unbedingt nötig (BGHZ 107, 384, 393 – Emil Nolde).
Teil I Die Rechtssubjekte› § 5 Begriff und Arten der juristischen Person des Privatrechts. Erwerb der Rechtsfähigkeit
§ 5 Begriff und Arten der juristischen Person des Privatrechts. Erwerb der Rechtsfähigkeit
Inhaltsverzeichnis
I. Begriff und Arten der juristischen Person
II. Erwerb der Rechtsfähigkeit
70
Fall 5:
Zehn Hoteliers und Gastwirte der Stadt S wollen sich zusammenschließen, um den Fremdenverkehr nachdrücklich zu fördern. Der Zusammenschluss soll für den Besuch der Stadt werben und alle Gewerbetreibenden unentgeltlich in sämtlichen den Fremdenverkehr betreffenden Fragen beraten. Als seinen Beitrag verspricht der Hotelier H, der Vereinigung ein kleines, sonst kaum nutzbares Eckgrundstück zu übereignen, auf dem eine Werbewand aufgestellt und ein kleines Holzgebäude errichtet werden sollen. Dort will man die Geschäftsräume der Vereinigung, insbesondere einen Hotelnachweis und eine Servicestelle für die Besucher unterbringen.
| 1. |
Welche Form ist für den Zusammenschluss zweckmäßig? |
| 2. |
Was gilt, wenn H sich weigert, das Grundstück zu übereignen, weil seine Verpflichtung nur in der privatschriftlichen Satzungsurkunde der Vereinigung enthalten ist? |
| 3. |
Welche Bedeutung hätte es für den Zusammenschluss, falls er zu diesem Zeitpunkt schon als Verein in das Vereinsregister eingetragen wäre? |
Teil I Die Rechtssubjekte› § 5 Begriff und Arten der juristischen Person des Privatrechts. Erwerb der Rechtsfähigkeit› I. Begriff und Arten der juristischen Person
I. Begriff und Arten der juristischen Person
71
1. Als Art des Zusammenschlusses kommen der Verein des BGB, die GmbH, die Genossenschaft, theoretisch auch die Aktiengesellschaft und die BGB-Gesellschaft in Betracht. Die erste Frage geht dahin, ob der Zusammenschluss eine selbstständige Rechtspersonwerden, also die Form einer juristischen Person gewählt werden soll. In diesem Fall erhält der Verein eine eigene Rechtspersönlichkeit; er selbst ist Träger der Rechte und Pflichten, die unmittelbar auf den Verein bezogen werden. Im anderen Fall, dh einem Zusammenschluss ohne eigene Rechtspersönlichkeit, sind Träger der Rechte und Pflichten grundsätzlich die zusammengeschlossenen Personen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Zusammenschlusses („Gemeinschaft zur gesamten Hand“). Die wichtigsten solcher Zusammenschlüsse sind die BGB-Gesellschaft (§§ 705 ff), OHG und KG (§§ 105 ff, 161 ff HGB), die für Freiberufler gedachte Partnerschaftsgesellschaft (zum PartGG vom 25.7.1994 und zur beschränkten Berufshaftung in § 8 IV PartGG vgl Römermann NJW 2013, 2305 ff) und der nichtrechtsfähige Verein, für den § 54 grundsätzlich auf das Recht der BGB-Gesellschaft verweist (s. unten Rn 106).
72
Die juristische Person ist eine Zusammenfassung von Personen (oder im Fall der selbstständigen Stiftung, §§ 80 ff, von zweckgebundenem Vermögen) zu einer Organisation, der die Rechtsordnung Rechtsfähigkeit verliehen hat. Personenzusammenschlüsse sind alle Arten der Vereine. Hierhin gehören der rechtsfähige Verein des BGB, und zwar der „nichtwirtschaftliche“ (sog. Idealverein) des § 21 und der „wirtschaftliche“ Verein des § 22. Auch die Aktiengesellschaft, die GmbH und die Genossenschaft sind in diesem Sinne Vereine, nämlich vom Mitgliederwechsel unabhängige Personenvereinigungen mit körperschaftlicher Verfassung und selbstständigem Auftreten im Rechtsverkehr. Körperschaftliche Verfassung bedeutet: Vorstand als Geschäftsführungs- und Vertretungsorgan, Mitgliederversammlung als Willensbildungsorgan (guter Überblick bei A. Grundmann/Terner , Vereinsrecht, JA 2002, 689 ff).
73
Die Rechtsfähigkeit der juristischen Personberuht auf einem Staatsakt, dessen Voraussetzungen für jede der abschließend aufgezählten Arten juristischer Personen (eV, AG, GmbH usw) nach ihren jeweiligen Aufgaben gesetzlich festgelegt sind (Typenzwang, s. unten Rn 87 ff).
Das bedeutet im Fall 5, dass sich die Beteiligten, wenn sie einen rechtsfähigen Zusammenschluss wollen, der vom Gesetz vorgesehenen Form bedienen und den konstitutiven Staatsakt veranlassen müssen.
74
Auch wenn die Rechtsfähigkeit der juristischen Person vor allem für deren Auftreten im Rechtsverkehr praktisch wichtig ist, sollte sie doch in ihrer Bedeutung nicht überschätzt werden. Für das Innenleben des Zusammenschlusses ist es wichtiger, ob er eine körperschaftliche oder gesellschaftsrechtliche Struktur im engeren Sinne hat; und das ist von der eigenen Rechtsfähigkeit des Zusammenschlusses unabhängig. So können die Mitglieder im Einzelfall Personengesellschaften körperschaftsähnlich (zB Publikums-KG) und Kapitalgesellschaften, insbesondere eine GmbH, wie eine Personengesellschaft ausgestalten. Auch das Nebeneinander von rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Vereinen, die grundsätzlich gleichbehandelt werden, zeigt, dass die Rechtsfähigkeit im täglichen Leben so ausschlaggebend nicht ist, soweit sie nicht das Gesetz für bestimmte Fälle zwingend vorschreibt.
Читать дальше