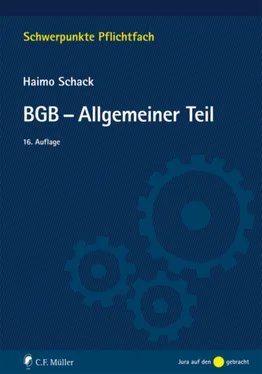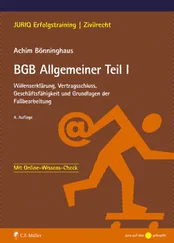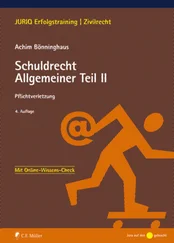88
2. Allgemeines Prinzip des deutschen Rechts ist also, dass die privatrechtlichen Vereinigungen Rechtsfähigkeit durch Eintragung in ein Registererwerben. Beim Verein ist es das Vereinsregister, bei der Aktiengesellschaft und der GmbH das Handelsregister, bei der Genossenschaft das Genossenschaftsregister, das im Grunde genommen ein auf die Genossenschaften beschränktes Handelsregister ist.
Neben den rechtsbegründenden Eintragungen gibt es solche, die einen ohne Registereintragung eingetretenen Erfolg dokumentieren. Die Eintragung ist dann nur Offenlegungsmittel, nicht Teil des Rechtsänderungsvorgangs; man nennt sie dann deklaratorisch (rechtserklärend). Nur deklaratorisch ist zB die Eintragung einer Änderung des Vereinsvorstandes nach § 67. Die Organstellung einschließlich der Vertretungsmacht des neuen Vorstandes entsteht bereits mit der Wahl und nicht erst mit der Eintragung.
89
Das Nebeneinander von konstitutiven und deklaratorischen Registereintragungengibt es auch im Grundbuch und bei sonstigen Eintragungen im Handelsregister. Die Eintragung der rechtsgeschäftlichen Änderung im Liegenschaftsrecht ist nach § 873 konstitutiv; sie führt zusammen mit der Einigung den Rechtserfolg erst herbei. Lässt sich dagegen der Erbe, der gemäß § 1922 mit dem Erbfall automatisch Eigentümer geworden ist, im Grundbuch eintragen, so ist die Eintragung deklaratorisch, sie stellt nur die wahre, außerhalb des Grundbuches eingetretene Rechtslage fest. Die Handelsregistereintragung eines Kaufmanns, der ein Handelsgewerbe nach § 1 HGB betreibt, ist deklaratorisch. Dagegen wird im Falle des § 2 HGB die Kaufmannseigenschaft erst durch die Eintragung begründet, ist hier also konstitutiv. Die Prokura wiederum entsteht mit der Erklärung des Geschäftsinhabers, die Eintragung ist also nur deklaratorisch, vgl §§ 48, 53 HGB.
Das Gesetz wählt die konstitutive Eintragung, wenn es ohne die staatliche Mitwirkung den Rechtserfolg nicht eintreten lassen will, die deklaratorische, wenn es ihm lediglich darauf ankommt, die eingetretene Rechtsfolge für alle interessierten Dritten ersichtlich zu machen. Oft ist die deklaratorische Eintragung nicht in das Belieben der Beteiligten gestellt, sondern das Gesetz zwingt sie, den eingetretenen Rechtserfolg ins Register eintragen zu lassen; vgl zB § 29 HGB.
90
3. Die Abhängigkeit der Entstehung der Rechtsfähigkeit von dem konstitutiven Staatsakt führt dazu, dass die zusammenschlusswilligen Bürger vom Staat abhängig werden. Diese Einschränkung der Vereinigungsfreiheit scheint auf den ersten Blick gegen Art. 9 I GG zu verstoßen. Doch garantiert dieses Grundrecht kein System der freien Körperschaftsbildung. Denn der Staat darf auf eine Mitwirkung bei der Entstehung juristischer Personen nicht völlig verzichten, da eine juristische Person, die wie eine natürliche mit eigenen Rechten und Pflichten im Rechtsleben steht, zu vielen Dritten in Beziehung treten kann. Vornehmlich deren Interessen sollen durch die Mitwirkung des Staates gesichert werden. Den Konflikt zwischen Rechtssicherheit und ungehinderter Vereinigungsfreiheit hat das geltende Recht dadurch gelöst, dass es den Erwerb der Rechtsfähigkeit zwar von einem konstitutiven Staatsakt abhängig macht, diesen Staatsakt aber nicht in das Ermessen der Behörde stellt, dem Bürger vielmehr einen Anspruch auf die konstitutive Eintragung gibt. Der Anspruch entsteht, wenn die abstrakt im Gesetz festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. Dann muss der Staat die Rechtsfähigkeit durch die Eintragung im Register herbeiführen. Dieses so genannte Normativsystemliegt der Entstehung der meisten juristischen Personen des Privatrechts zugrunde, nämlich der des nichtwirtschaftlichen Vereins in § 21, der AG, der GmbH und der Genossenschaft. Das Normativsystem ist eine Synthese des Freiheits- und Ordnungsprinzips. Zum Ganzen vgl H. Westermann , Der konstitutive und deklaratorische Hoheitsakt als Tatbestand des Zivilrechts, FS Michaelis 1972, S. 337–353.
91
Daneben kennt das BGB in § 22 noch das Konzessionssystemfür wirtschaftliche Vereine (für Stiftungen 2002 gelockert in § 80). Hier steht die Verleihung der Rechtsfähigkeit im – allerdings pflichtgemäßen – Ermessen der genehmigenden Behörde. Vereine des § 22 sind selten, ein Beispiel ist die Verwertungsgesellschaft GEMA. Wenn die Mitglieder der Vereinigung wirtschaftliche Zwecke verfolgen wollen, wird sie die Behörde vorrangig auf eine der Rechtsformen des Handelsrechts (AG, GmbH, Genossenschaft) verweisen.
92
4. Nach dem Normativsystem ist zu entscheiden, ob im Fall 5der Verein eingetragen werden kann. Die erste Voraussetzung ist, dass er „ nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtetist“. Nun könnte man annehmen, dass hieran die Eintragung des Vereins scheitern muss, da der Verein den Gewerbebetrieb seiner Mitglieder unterstützen soll; letztlich kommt ja der gesteigerte Fremdenverkehr den Gaststätten zugute. Die Rechtsprechung lässt aber zu Recht nicht entscheiden, ob letzten Endes ein geschäftlicher Vorteil erstrebt wird, sondern sie nimmt einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nur an, wenn der Verein selbst mit Gewinnerzielungsabsicht am Rechtsverkehr teilnimmt, wobei es dann gleichgültig ist, ob der Gewinn für den Verein selbst oder für die Mitglieder erzielt werden soll.
93
Ein interessanter Fall ist BGHZ 45, 395: Taxiunternehmen schlossen sich zu einem Verein (Funkzentrale) zusammen, der den Kunden die Wagen vermitteln sollte. Auch wenn die Benutzer für die Vermittlung an den Verein kein Entgelt zahlten, der Verein insofern also nicht am allgemeinen Rechtsverkehr teilnehmen sollte, trat er als Hilfsmittel der Mitgliederunternehmen dauernd und planmäßig in Rechtsbeziehungen zu Dritten; er war danach kein Idealverein iSv § 21. (Ebenso für einen Eigentümer-Verein, der eine Hausmeisterwohnung verwalten sollte, OLG Frankfurt/M NJW-RR 2006, 1698.) Im Unterschied dazu verfolgt der Fremdenverkehrsverein im Fall 5primär ideelle Zwecke, er will selbst keine unternehmerische Tätigkeit entfalten.
Maßgebend für die Abgrenzung ist letztlich, dass man Vereine, die in größerem Ausmaß am allgemeinen Rechtsverkehr teilnehmen, den Normen des Handelsgesellschaftsrechts unterwerfen will, die durch die Bindung des Kapitals, die Pflichten und Haftung der Organe usw stärker als das Vereinsrecht die Interessen Dritter und auch der Mitglieder berücksichtigen.
94
Die Abgrenzung ist problematisch geworden, denkt man an die Millionenumsätze der Profifußballvereine. Sie stehen in solchem Maße im Wirtschaftsleben (Gehälter für Spieler, Trainer; Transfergeschäfte; Einnahmen durch Kartenverkauf, Werbung), dass sie eigentlich dem Handelsgesellschaftsrecht (Buchführungspflicht, Haftung) unterworfen werden müssten. Die Praxis indes duldet die Form des eV, wohl weil die Form der Handelsgesellschaft insbesondere angesichts des wechselnden Mitgliederbestandes der Fußballvereine nicht recht passt, und nimmt dabei Lücken beim Gläubigerschutz in Kauf. Inzwischen allerdings haben sich nach Borussia Dortmund (als GmbH & Co KGaA, vgl §§ 278 ff AktG) etliche Fußballvereine der 1. Bundesliga als GmbH oder Aktiengesellschaft konstituiert.
Bei Fußballvereinen wird das Nebenzweckprivileg, demzufolge eine untergeordnete wirtschaftliche Betätigung dem Idealverein nicht schadet, arg strapaziert; der Schwanz wackelt mit dem Hund. Wo es nicht um Sport geht, ist die Praxis rigoroser (zB OLG Düsseldorf NJW 1983, 2574 – Scientology Center, s. unten Rn 135). Kritik am Nebenzweckprivileg üben auch Medicus/Petersen 11Rn 1112; K. Schmidt , Der bürgerlich-rechtliche Verein mit wirtschaftlicher Tätigkeit, AcP 182 (1982) 1, 26 ff; Soergel/Hadding , BGB I 132000, § 21 Rn 33 ff. Unschädlich ist eine Ausgliederung der Wirtschaftstätigkeit auf ein rechtlich selbstständiges Tochterunternehmen (BGHZ 85, 84: ADAC-Rechtsschutzversicherungs-AG), weil dessen Gläubiger dann durch dessen Rechtsform ausreichend geschützt sind.
Читать дальше