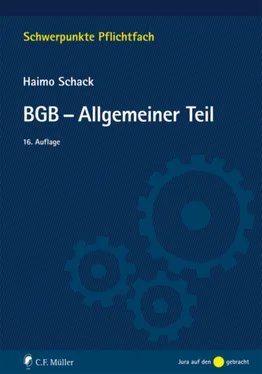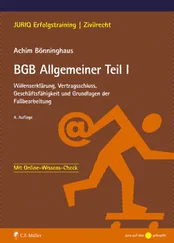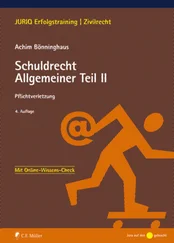Eine solche Einzelübertragung läge vor, falls V die Forderung gegen K auf einen anderen, etwa den Übernehmer seines Handelsgeschäfts, übertragen hätte. Selbst wenn der Inhaber sein gesamtes Unternehmen veräußert, liegt nämlich keine Gesamtnachfolge, sondern eine Summe von Einzelnachfolgen in die zum Unternehmen gehörenden Gegenstände vor.
22
Gesamtnachfolge gibt es nur, wo das Gesetz sie ausdrücklich angeordnet hat, wie für den Erbfall, § 1922 (gleichgestellt ist der Anfall des Vereinsvermögens an den Fiskus, § 46); Vermögensübertragung bei Eintritt der allgemeinen Gütergemeinschaft, § 1416 II; Verschmelzung von Gesellschaften, § 20 UmwandlungsG. Soll eine Vermögenseinheit auf ein anderes Rechtssubjekt übergehen, ohne dass ein Tatbestand der Gesamtnachfolge gegeben ist, dann muss jeder einzelne Vermögensgegenstand in der für ihn maßgebenden Form übertragen werden. Das kann sehr umständlich und kostspielig sein.
Beispiele:
Der Hofeigentümer will seinen Hof auf seinen künftigen Erben unter Lebenden übertragen. Zu dem Hof als Wirtschaftseinheit gehören die Grundstücke (und Gebäude als deren wesentliche Bestandteile), Vorräte (zB Saatgut, Futter für das Vieh), Inventar (Geräte, Maschinen), Vieh.
Oder: Der Inhaber einer Maschinenfabrik verkauft das Unternehmen. Zu der Wirtschaftseinheit gehören Grundstücke mit Gebäuden, Maschinen, Patente, Betriebsgeheimnisse, Forderungen, laufende Verträge, in die der Übernehmer des Unternehmens eintreten soll, usw. Vgl unten Fall 8( Rn 147).
Im Fall 2ist die eventuelle Forderung des V gegen den K also im Wege der Gesamtnachfolge auf den Erben des V übergegangen.
Teil I Die Rechtssubjekte› § 2 Ende der Rechtsfähigkeit. Todeserklärung. Verjährung. Vollmacht über den Tod hinaus› II. Todeserklärung
23
Gesetzlicher Erbe des V ist S, § 1924, falls er am 15.12.2018 noch gelebt hat, § 1923 I. Er schließt dann B, die in der zweiten Erbfolgeordnung steht, § 1925, von der Erbfolge aus, § 1930. Nun ist nicht sicher, dass S gestorben ist, wenn auch sein Tod sehr wahrscheinlich ist. B kann also, wenn sie die Erbschaft nach V in Anspruch nehmen will, nicht beweisen, dass S vorverstorben ist. Auch der Erfolg eines Handelns für S hinge davon ab, ob S noch lebt. Angesichts der Unsicherheit über das Schicksal des S findet sich also niemand, der die Forderung geltend machen kann.
24
1. In solchen Fällen der Unsicherheit über Leben und Tod einer Person spricht man von Verschollenheit. Das Verschollenheitsgesetz vom 15.1.1951 (BGBl I 63) ermöglicht es, einen Verschollenen für tot zu erklären. Man unterscheidet die allgemeine Verschollenheit, § 3, und die Verschollenheit in besonderen Gefahrenfällen. Im Fall 2ist der Tatbestand der Seeverschollenheit des § 5 erfüllt.
Die Verschollenheit ändert an der Rechtsfähigkeit des Verschollenen nichts; sie erlaubt nur, den S für tot zu erklären. Das geschieht durch Gerichtsbeschluss im Aufgebotsverfahren (öffentliche Aufforderung an den Verschollenen und an alle, die Auskunft geben können, sich zu melden) gemäß §§ 13 ff VerschG.
25
2. Die Todeserklärung schafft eine Vermutung, dass der für tot Erklärte in dem im Beschluss festgelegten Zeitpunkt gestorben ist, § 9 VerschG. Für die Seeverschollenheit wird als Todeszeitpunkt der Untergang des Schiffes vermutet, § 9. Die Todeserklärung wird also als Todeszeitpunkt des S den 12.12.2014 annehmen. Die Todeserklärung beendet die Rechtsfähigkeit nicht. Einen solchen Erfolg kann der Gerichtsbeschluss nicht herbeiführen. Denn die Rechtsfähigkeit kann einem Menschen nicht entzogen werden.
Anders früher durch den bürgerlichen Tod als Strafe oder den Klostertod beim Eintritt in ein Kloster. Letzteres war besonders praktisch, da das Kloster dann erben konnte! Einen Lebenden seiner Rechtsfähigkeit zu berauben, wäre heute mit Art. 1 I GG unvereinbar.
26
Die Rechtsfähigkeit des für tot Erklärten endet also ausschließlich mit seinem wirklichen Tod. Ist er vor dem im Beschluss festgelegten Zeitpunkt gestorben, dann endet sie vorher; hat er den Zeitpunkt überlebt, so ändert der Beschluss an der Rechtsfähigkeit und an der materiellen Rechtslage nichts. Jedoch löst die durch die Todeserklärung geschaffene Vermutung bis zu ihrer Widerlegung Rechtswirkungen aus.
Also kann B nach der Todeserklärung des S die Erbschaft als gesetzliche Erbin in Anspruch nehmen. Sollte S jedoch wider Erwarten zurückkehren, dann kann er selbstverständlich die Herausgabe seines „Nachlasses“ von B fordern; vgl §§ 2018, 2031.
27
3. Mit Vermutungenarbeitet das Gesetz auch sonst. Es gibt widerlegliche Vermutungen (so außer §§ 9 ff VerschG zB §§ 891, 1006) und unwiderlegliche (so zB §§ 545, 892, 1566, 2365 f). Unwiderlegliche Vermutungen dienen vor allem dazu, denjenigen zu schützen, der im Vertrauen auf den Vermutungstatbestand durch Rechtsgeschäft etwas erwerben will; typisch hierfür sind §§ 892, 2366.
28
Daneben gibt es noch die Fiktionen. Eine Fiktion liegt vor, wenn an einen bestimmten Tatbestand die Rechtsfolge eines anderen, in casu nicht gegebenen Tatbestandes geknüpft wird. Charakteristisch für eine Fiktion ist meist das Wort „gilt“. Vgl zB § 891 (Vermutung) mit § 1923 II (Fiktion): Im Fall der §§ 891, 892 kann das Grundbuch richtig oder unrichtig sein. In § 1923 II dagegen steht fest, dass das Kind zur Zeit des Erbfalls noch nicht lebte; die Rechtslage soll aber so sein, als ob das Kind schon geboren wäre. Die Fiktion behandelt also zwei ungleiche Tatbestände bewusst gleich, indem sie dieselbe Rechtsfolge anordnet. Mit dieser Gesetzestechnik erspart sich der Gesetzgeber, ähnlich wie bei einer Verweisung, eine selbstständige Regelung. Vgl Larenz , Methodenlehre 61991, S. 262 ff; Köhler 41§ 3 Rn 16.
Teil I Die Rechtssubjekte› § 2 Ende der Rechtsfähigkeit. Todeserklärung. Verjährung. Vollmacht über den Tod hinaus› III. Verjährung
29
Wird S für tot erklärt, dann steht mit dem Erbrecht der B auch fest, dass sie Gläubigerin der evtl. Forderung gegen K geworden ist. Angesichts des Zeitablaufs seit Entstehen der streitigen Forderung hat B ein Interesse daran zu verhindern, dass die Forderung verjährt, vgl § 194.
30
1. Verjährung bedeutet nicht das Erlöschen der Forderung. Die Verjährung gewährt dem Schuldner vielmehr ein bloßes Leistungsverweigerungsrecht, § 214 I. Wenn er diese Einrede erhebt, kann der Schuldner nicht mehr zur Leistung gezwungen werden. Wohl aber darf sie der Gläubiger behalten, wenn sie der Schuldner ungeachtet der Verjährung bewirkt hat, § 214 II (vgl § 813 I). Auch ist der Gläubiger einer verjährten Forderung nicht gehindert, sich aus einem Sicherungsrecht zu befriedigen (§ 216 II 2 jetzt ausdrücklich auch für den Eigentumsvorbehalt!); vgl auch § 215. Im Gegensatz zur Einrede führt eine Einwendung dazu, dass das mit der Einwendung behaftete Recht gar nicht erst entsteht oder aber untergeht (s. unten Rn 573 f).
31
Die Verjährung ist als bloße Einrede streng zu unterscheiden vom Erlöschen eines Rechts infolge des Ablaufs einer Ausschlussfrist, der zu einer rechtsvernichtenden Einwendung führt. Das in Unkenntnis einer abgelaufenen Ausschlussfrist Geleistete kann gemäß § 812 I 1, 1. Alt. (Leistungskondiktion) zurückgefordert werden. Ausschlussfristen dienen der Rechtssicherheit. Das Gesetz verwendet sie vor allem, um die Ausübung einseitiger Gestaltungsrechte zeitlich zu begrenzen, zB §§ 121, 124 (s. unten Rn 233), §§ 626 II 1, 314 III; vgl auch §§ 864, 1002. Besondere Beschleunigungsmittel sind die Rechtsverluste bei Versäumung der gemäß § 377 HGB gebotenen unverzüglichen Untersuchung und Rüge gekaufter Handelsware.
Читать дальше